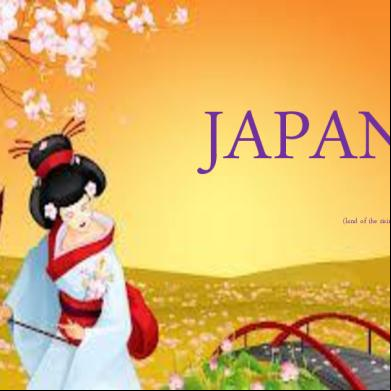Japan 6u4f5f
This document was ed by and they confirmed that they have the permission to share it. If you are author or own the copyright of this book, please report to us by using this report form. Report 2z6p3t
Overview 5o1f4z
& View Japan as PDF for free.
More details 6z3438
- Words: 18,294
- Pages: 40
NEWS
GESUNDHEIT
TIPPS
FITNESS
ERNÄHRUNG
FOTOMONTAGE: DPNY
AKTUELLE GESUNDHEITS-INFORMATIONEN FÜR KUNDEN DER MEDICOM PHARMA AG . 27. Ausgabe, Dezember 2003
Editorial
Viel Spaß beim Lesen wünscht Ihnen Ihre
I
m Hintergrund schneebedeckte Wipfel, sonnenbeschienene Gärten und ein Tempel im Vordergrund. So kennen wir den japanischen Winter von den bunten Bildern, die zumeist die Wände japanischer Restaurants schmücken. Gerade jetzt um die kalte Jahreszeit, suchen Sie ein Restaurant vielleicht sogar noch öfter auf als im Sommer. Und beim Japaner sitzen Sie richtig. Warum? Weil die Japaner sehr viel länger leben als wir westlichen Menschen und auch im hohen Alter noch bei bester Gesundheit sind. In keinem anderen Land auf der Erde leben so viele so gesunde ältere Menschen. Und das liegt zu einem sehr großen Teil an der gesunden Ernährung. „Da können wir uns etwas abgucken“, haben wir uns in der MEDICOM-Redaktion gedacht – und eine MEDICOM fast ausschließlich zum Thema Japan verfasst.
Petra Wons Vorstand der Medicom Pharma AG
So lange und gesund leben wie die Japaner? Natürlich, das möchten wir alle. Aber müssen wir deshalb rohen Fisch essen, Buddhisten werden und stundenlang in Stellungen verharren, die uns an Verrenkungen erinnern? Keineswegs. Wenngleich viele Dinge es vielleicht wert sind, einmal ausprobiert zu werden. Machen Sie sich einfach selbst ein Bild. Tauchen Sie ein in die Kultur des Landes der aufgehenden Sonne. Sie begegnen in dieser Ausgabe Teemeistern und Zen-Mönchen, lesen, was es mit schintoistischen Opfergaben und der Lebensenergie Ki (oder Qi) auf sich hat, und erfahren, warum die japanische Heilkunst so erfolgreich ist. Vielleicht interessiert es Sie, warum „kämpfen“ und „heilen“ für Japaner nicht in einem Widerspruch stehen, und Sie lernen die gewaltfreie Kampfkunst Aikido kennen. Wer war Buddha und wie lautet seine Lehre? Auf den Seiten 20/21 haben wir unter der Überschrift „Buddhismus – das einzig Beständige ist der stetige Wandel“ naheliegende Fragen zu einer der größten Religionen des Ostens beantwortet. Was ist das Nirvana? Was hat es mit der Wiedergeburt auf sich? Ist Buddha ein Gott? Lassen Sie sich von einer ungewohnten Sichtweise überraschen.
Vielleicht haben Sie sie auch schon gesehen, sei es bei einem Spaziergang durch den Park oder am Strand: „Schattenboxer“, Menschen, die sich mit seltsamer Langsamkeit um sich selber zu drehen scheinen und dabei sonderbare Positionen einnehmen. Tai Chi Chuan, Meditation in Bewegung. Ab Seite 29 erfahren Sie mehr über die Bewegungskunst. Wer Tai Chi Chuan praktiziert, lernt die Energie des Geistes zu bündeln und auf ein bestimmes Ziel hin auszurichten. Die Bewegungskunst gilt – neben vielen anderen Aspekten der japanischen Kultur – als eine Methode, die es den Japanern möglich macht, sehr lange gesund zu bleiben, und es gibt zahlreiche Studien, die die gesundheitsförderliche Wirkung belegen. All die Aspekte einer gesunden Lebensführung, die zu einem erfüllten und langen Leben der Menschen in Japan beitragen, wären natürlich nicht vollständig, wollten wir den langlebigen Japanern nicht in die Töpfe und auf die schön dekorierten Teller schauen. Der wahrscheinlich sogar ausschlaggebendste Aspekt für die gute und lange Gesundheit der Japaner ist die leichte, vitalstoffreiche und auch köstliche Küche. Lassen Sie sich ab Seite 32 inspirieren!
Inhalt
Titelthema: Japan
12
Ab Seite
Im Land des Lächelns lebt man länger Japaner haben die höchste Lebenserwar-
meister, schlendern
tung. Frauen werden im Durchschnitt 85
Sie durch die Straßen Tokios,
Jahre alt, Männer erreichen ein Durch-
und entdecken Sie dabei das japani-
schnittsalter von 78 Jahren. Woran liegt
sche Geheimnis des langen Lebens.
das? Die MEDICOM hat sich auf der Suche nach einem schönen, langen und gesunden Leben im Land der aufgehenden Sonne umgeschaut. Besuchen Sie die Zen-
Körper & Seele
20
Ab Seite
Buddhismus
Das einzig Beständige ist der stetige Wandel In Japan sind der Buddhismus und der Schintoismus
22
Was ist Buddhas Lehre?
Neues aus der Forschung:
4 4 5 5 6 7 8 8
Gesundheit & Recht Gerichtsurteile
die beiden Hauptreligionen. Was ist ein Buddhist?
Ab Seite
Kurzmeldungen Wir werden immer netter! Folsäure gegen Depressionen Zigaretten: Zusätze machen süchtig Gesundheits-Meldungen Enkel hüten und länger leben Gesündere Ernährung? Leider nein! Entzündliche Darmerkrankungen Alles klar mit Heidelbeeren
Soja
Länger gesund mit „pflanzlichen Hormonen“ Manche Pflanzen verfügen über Heilkräfte. Phyto-Östrogene, also pflanzliche Inhaltsstoffe, die ähnlich wie Östrogene wirken können, sind in Soja und in Leinsamen enthalten. Sie sind ideal gegen Wechseljahresbeschwerden.
Ab Seite
29
Bewegung & Fitness: Tai Chi Chuan Meditation in Bewegung Ein chinesischer Mönch beobachtete einst fasziniert den Kampf zwischen einer Schlange und einem Kranich. Wie daraus eine Bewegungskunst wurde, die es sich zum Ziel setzt, den Körper und die Seele zu vereinen, lesen Sie hier.
Essen und Trinken: Asia-Food Leicht, gesund und lecker. Die asiatische Küche vereint traditionell Gesundheitslehren und guten Geschmack. Gerade auch in der Esskultur liegt der Schlüssel zu einem langen und gesunden Leben.
Ab Seite
9
MEDICOM informiert Keine Chance für Salmonellen Himalaya-Salz: ohne Vorteile
10 11
Titelthema Japan: Im Land des Lächelns lebt man länger
12
Körper & Seele Buddhismus: Das einzig Beständige ist der stetige Wandel
20
Neues aus der Forschung Soja: Länger gesund mit „pflanzlichen Hormonen“
22
Vitalstoff-Lexikon Gamma-Linolensäure Omega-3-Fettsäuren
25 26
Bewegung & Fitness Tai Chi Chuan – Meditation in Bewegung
29
Essen & Trinken Asia-Food Vitalstoffrezept
32 37
Rubriken Editorial Impressum Leserbriefe Rätselseite
2 38 38 39
32 MEDICOM 27. Ausgabe, Dezember 2003
3
Wir werden immer netter!
FOTO: PHOTODISC
issenschaftler haben bewiesen, dass wir (entgegen der verbreiteten Ansicht) im Alter nicht mürrischer, sondern netter werden. Amerikanische Forscher haben jetzt in einer Studie über 130.000 Personen im Alter zwischen 21 und 60 Jahren auf fünf Persönlichkeitsmerkmale hin untersucht. Bis auf die Offenheit, die generell bei Frauen und Männern leicht abnahm, scheinen sich alle Merkmale zumindest bei einigen der untersuchten Gruppen mit dem Alter zu verbessern. Verträglicher werden die Menschen vor allem in den Dreißigern. Beim Neurotizismus (Emotionale Labilität) und bei der Extraversion (Aufgeschlossenheit) unterscheiden sich Frauen und Männer: Frauen werden allmählich weniger neurotisch und emotional labil, dafür aber in sich gekehrter. Männer dagegen verändern sich offenbar kaum in diesen beiden Punkten. Beide Eigenschaften, Neurotizismus und Extraversion, sind nach der Studie bei jungen Frauen deutlich stärker ausgeprägt als bei jungen Männern. Das würde bedeuten, dass sich die beiden Geschlechter in manchen Charaktereigenschaften mit zunehmendem Alter immer mehr angleichen. Die Ergebnisse wurden im Fachmagazin „Journal of Personality and Social Psychology“ (Mai 2003) veröffentlicht. Offenbar ändert sich die Persönlichkeit mit fortgeschrittenem Alter sogar noch mehr als vorher. Das lässt sich damit erklären, dass etwa ein stärkeres Pflichtbewusstsein und eine bessere emotionale Stabilität ein Ausdruck für eine höhere Reife einer Person sind, so die Forscher.
Eine Studie belegt: Vor allem in den Dreißigern werden die Menschen vertäglicher.
4
MEDICOM 27. Ausgabe, Dezember 2003
FOTO: PHOTODISC
W
Darum lieb´ ich alles, was so grün ist – weil es so reich an Folsäure ist ... Doch aufget: Folsäure ist das „Sensibelchen“ unter den Vitaminen. Langes Kochen und Warmhalten sind „Folsäure-Killer“, daher sind viele Menschen unterversorgt, was die Folsäure angeht.
Folsäure gegen Depressionen Forscher vermuten einen Zusammenhang zwischen dem Vitamin aus der B-Gruppe und geistiger Gesundheit
D
epressionen können mit einem Mangel an Folsäure oder einer gestörten Verwertung des Vitamins zusammenhängen. Norwegische Wissenschaftler fanden jetzt Hinweise für die Richtigkeit dieser schon länger bekannten These. Depressive Menschen haben häufig einen sehr hohen Spiegel der Aminosäure Homocystein im Blut. Folsäure fördert den Abbau dieser Aminosäure, weshalb viel Homocystein im Blut auf einen Mangel an Folsäure hindeutet. Die Fachzeitschrift „Archives of General Psychiatry“ (Bd. 60, S. 618) berichtet über eine Studie der Universität von Bergen in Norwegen, bei der bei knapp sechstausend Probanden die Blutkonzentration von Homocystein gemessen wurde. Tatsächlich waren die Studienteilnehmer, die hohe Konzentrationen an Homocystein im Blut hatten, doppelt so häufig depressiv wie die Personen mit den geringsten Mengen dieser Aminosäure. Einen weiteren Hinweis ergab eine DNAAnalyse. Bei den Menschen, die stark zu Depressionen neigten, war ein bestimmtes Gen verändert, das normalerweise eine wichtige Rolle im Folsäure-Stoffwechsel
spielt. Frühere Untersuchungen hatten bereits ergeben, dass Folsäure die Wirkung von Antidepressiva eindeutig verstärken kann. Auf welche Weise das B-Vitamin die Entstehung von Depressionen verhindern könnte, ist den Wissenschaftlern noch unklar. Möglich ist es, dass Folsäure an der Bildung bestimmter Substanzen im Gehirn beteiligt ist, durch deren Fehlen Depressionen und mentale Störungen ausgelöst werden. Die Wissenschaftler sehen in dem Studienergebnis die Bestätigung, dass Vitamine nicht nur für die körperliche, sondern auch für die geistige Gesundheit unentbehrlich sind. 90 Prozent der Deutschen sind jedoch unterversorgt, was Folsäure angeht. Besonders reich an Folsäure sind Spinat, grüne Erbsen, Grünkohl, Wirsing oder Rosenkohl. Wer diese Lebensmittel nicht häufig verzehrt, sollte zu Nahrungsergänzungsmitteln greifen, die Folsäure enthalten, um den Bedarf zu decken. Das gilt auf jeden Fall für Frauen mit Kinderwunsch und für schwangere und stillende Frauen.
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
Gesundheits-Meldungen ganz
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
Zigaretten: Zusätze machen süchtig Moderne Zigaretten enthalten mehr Suchtstoffe Nikotin macht vor allem in einer bestimmten Form süchtig, und die Zigarettenindustrie sorgt dafür, dass diese Form in hoher Konzentration in den Zigaretten enthalten ist.
N
ikotin kann in zwei verschiedenen Formen vorliegen. Die so genannte freie Form geht schnell vom festen Tabak in den Rauch über. Dadurch wird das Nikotin beim Rauchen unmittelbar in die Lunge und von hier ins Gehirn transportiert. Die andere Form des Nervengiftes, die so genannte protonierte Form, verdampft nur sehr langsam und kommt nur in geringen Mengen im inhalierten Rauch vor. Je schneller das Nikotin im Gehirn ankommt, desto stärker ist das Suchtpotenzial. Die Zusammensetzung der Zigarette bestimmt, wie viel Nikotin in der freien Form vorliegt, und damit, wie abhängig eine Zigarette macht. Diesen Faktor nutzen manche Tabakkonzerne aus und erhöhen durch Zusätze wie zum Beispiel Harnstoff die Menge an freiem also süchtig machendem Nikotin in ihren Produkten. Eine jetzt in der Online-Ausgabe der Fachzeitschrift „Chemical Research in Toxicology“ (Ausgabe Juli) veröffentlichte Studie bringt zum ersten Mal die erhöhte Konzentration freien Nikotins in modernen Zigaretten mit bestimmten Zusätzen
in Verbindung, die von der Zigarettenindustrie verwendet werden. Studienleiter James F. Pankow und sein Team von Chemikern entwickelten ein neues Verfahren, um die tatsächliche Menge süchtig machenden Nikotins im Zigarettenrauch zu messen. Die Wissenschaftler von der Oregon-Universität für Gesundheit und Wissenschaft fanden dabei deutlich höhere Konzentrationen des gefährlichen freien Nikotins, als bislang vermutet wurde. Die chemische Zusammensetzung und damit der Anteil an freiem Nikotin variierte zudem von Marke zu Marke. „Die Studie zeigt, dass das Nikotin in modernen Zigaretten genauso verändert wird wie Kokain bei der Crack-Herstellung“, kommentiert der Suchtexperte Jack Henningfield von der John-Hopkins-Universität das Untersuchungsergebnis. Die „moderne“ und extrem gefährliche Droge Crack besteht aus der „freien“ Form des Kokains, das ebenso wie das „freie“ Nikotin sehr viel schneller ins Gehirn gelangt als die „gebundene Form“ des Grundstoffs.
Jeder weiß es: Rauchen ist weit mehr als ein lästiges Laster. Es ist eine lebensbedrohliche Sucht. Dennoch zerstören täglich Millionen Raucher in Deutschland ihr Lungengewebe mit den tödlichen Sargnägeln.
FOTO: PHOTODISC, DPNY
Wunden heilen durch Schreiben Seine negativen Gefühle zu Papier zu bringen, lässt Hautwunden schneller heilen. Britische Psychologen wiesen in einer Studie nach, dass kleine Hautwunden derjenigen Probanden schneller verheilten, die regelmäßig über ihre negativen Gefühle bei einem aufregenden Ereignis schrieben. Das Schreiben über triviale Gefühle verhalf zu keiner schnelleren Heilung. + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
Schmerzmittel mit Bananen einnehmen Schmerzmittel sollten zusammen mit einem gut bekömmlichen Nahrungsmittel wie Bananen eingenommen werden, um die Magenschleimhaut zu schützen. Das Medikament wird dann zwar langsamer vom Körper aufgenommen, so dass sich die Wirkung erst später zeigt, Magenprobleme werden so aber vermieden. Viele Menschen reagieren mit Magenschmerzen auf die Wirkstoffe von Schmerzmitteln. + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
Krawatten lockerer binden Männer, die ihre Krawatten zu eng binden, riskieren eine Erkrankung der Augen. Zu enge Knoten erhöhen vermutlich den Augeninnendruck und steigern so das Risiko, an grünem Star zu erkranken. Wissenschaftler vermuten, dass der enge Schlips die Halsschlagader zusammenpresst und dadurch den Druck in dem Blutgefäß erhöht. Als +Folge + + + +davon + + + + steigt + + + + der + + +Augeninnendruck. + + + + + + + + + + + + + + „Frühstücker“ sind gesünder Der Verzicht auf das Frühstück ist ein Indiz für ein insgesamt ungesundes Leben. Forscher fanden heraus, dass „Frühstücksverweigerer” zu einem höheren Nikotin- und Alkoholkonsum tendieren und auch sonst wenig Wert auf ihre Gesundheit legen. Diejenigen, die auf die erste Mahlzeit verzichten, neigen bereits am Vormittag dazu, +ungesunde + + + + + + + Snacks + + + + + zu + + konsumieren. + + + + + + + + + + + + + + + Optimismus schützt vor Erkältungen Optimisten sind seltener verschnupft als notorische Griesgräme, und sie leiden auch an weniger schweren Symptomen. In einer Studie befragten Wissenschaftler die Teilnehmer nach ihrem Gemütszustand und sprühten ihnen danach eine Lösung mit Rhinoviren, den üblichen Erregern von Erkältungen, in die Nase. Menschen mit positiver Grundeinstellung litten danach seltener an Sympto+men, + + + die + + +auch + + + + + + + + + + +ausgeprägt + + + + + + + +waren. + + + + schwächer Werte wieder im Trend Nicht schicke Klamotten und viel Taschengeld schätzen Schulkinder an ihren Altersgenossen, sondern Freundlichkeit und Leistung. Wissenschaftler befragten Acht- bis Zehnjährige, wie sie sich selbst und andere einschätzen, welches Verhalten in der Gruppe besonders erfolgreich sei und welches sie selber für gut hielten. Ergebnis: Wer gute Noten hat, seine Kameraden begeistern kann, sportlich und freundlich ist, genießt das höchste Ansehen.
Enkel hüten und länger leben Forscher stellt neue Theorie zum Altern auf Eigentlich macht es biologisch gesehen und für die Erhaltung einer Art wenig Sinn, dass manche Lebewesen – einschließlich des Menschen – sich auch dann noch bester Gesundheit erfreuen, wenn sie keinen Beitrag mehr zur Fortpflanzung leisten.
M
enschen, Delfine und andere Säugetiere leben jedoch noch lange über ihre reproduktive Phase hinaus. Biologisch gesehen macht das, wie gesagt, wenig Sinn. Der amerikanische Forscher Ronald Lee von der University of California hat nun eine neue Theorie entworfen und gezeigt, dass nicht nur die Geburt der Kinder, sondern auch deren Aufzucht eine große Rolle spielt. An diesem Punkt kommen die älteren Generationen zurück in den evolutionären Kreislauf: bei der Pflege der Enkel. Die These: Je mehr sich die ältere Generation – sowohl beim Menschen als auch bei den Tieren – an der Aufzucht der Jüngsten beteiligt, desto älter werden die Senioren.
Als Beispiel nennt Lee Pilot-Wale. Diese Tiere pflegen ihren Nachwuchs intensiv – und zwar nicht nur die Kinder, sondern auch die Enkel. Die Wale leben sehr viel länger, als sie sich fortpflanzen können. Im Gegensatz dazu ist es für eine Art, die sich nach der Geburt überhaupt nicht mehr um den Nachwuchs kümmert, biologisch ausreichend, wenn sie nur so lange lebt, wie sie sich fortpflanzen kann. Wenn Eltern und Großeltern in der Aufzucht eine wichtige Rolle spielen, ist es für die Art sinnvoll, die Lebenszeit der Individuen zu verlängern. Diese Theorie ist auch für den Menschen anwendbar und erklärt das lange Leben von Senioren über ihre reproduktive Phase hinaus. Die Studienergebnisse wurden in der amerikanischen Fachzeitschrift „Proceedings of the National Academy of Sciences“ veröffentlicht.
FOTO: PHOTODISC
Die Studie: Mit einem neuen mathematischen Modell untersuchte der Spezialist für Demographie (Bevölkerungsentwicklung) den Zusammenhang zwischen der Lebenserwartung und der Fürsorge, die die Älteren den Kindern angedeihen ließen.
Das Fazit: Die Pflege des Nachwuchses bestimmt ganz wesentlich den Alterungsprozess der Senioren.
Wenn sich Opa um den Kleinen kümmert, profitieren beide. Enkel hüten hält nämlich nicht nur jung, sondern lässt den Senior auch älter werden.
ANZEIGE
Gesündere Ernährung? Leider nein! Der Trend zu gesunder Ernährung scheint vorläufig gestoppt zu sein. Zu diesem ebenso überraschenden wie bedauerlichen Ergebnis kam das GSF-Forschungszentrum für Umwelt und Gesundheit auf der Basis vier groß angelegter Studien zum Ernährungsverhalten in Deutschland.
V
on 1984 bis 2001 haben die Forscher das Ernährungsverhalten der Menschen im Raum Augsburg untersucht. Das Ergebnis: Der Trend zur gesunden Ernährung hatte seinen vorläufigen Höhepunkt bereits in der zweiten Hälfte der achtziger Jahre erreicht. Er hielt zwar bis 1995 weiter an, im Verlauf bis 2001 trat dann allerdings eine leichte Verschlechterung des Essverhaltens ein.
raum von 1984 bis 1990. Bis 1995 verbesserte sich das Verhalten nur noch leicht, danach verschlechterte es sich sogar. Leider kann man zudem davon ausgehen, dass diese Ergebnisse noch „geschönt“ sind. Studienteilnehmer geben erfahrungsgemäß eher Antworten in Richtung gesunder als in Richtung ungesunder Ernährung. Die Untersu-
An den vier Studien nahmen jeweils zwischen 4.000 und 5.000 Männer und Frauen im Alter von 25 bis 74 Jahren aus der Region Augsburg teil. In standardisierten Interviews wurden sie jeweils nach dem Verzehr von mehr als 20 verschiedenen Lebensmittelgruppen befragt. Danach bewerteten die Wissenschaftler die gemachten Angaben anhand der Empfehlungen der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE) zur Vorbeugung von Herz-Kreislauferkrankungen. „Täglicher Obstkonsum“ wurde zum Beispiel mit 2 Punkten bewertet, während „Obstkonsum seltener als einmal die Woche“ keinen Punkt erhielt. Die Summe aller Punkte ergab dann das Maß, anhand dessen das Ernährungsverhalten der Studienteilnehmer insgesamt bewertet wurde. Fazit: Die größten Veränderungen in Richtung einer gesünderen Ernährung erfolgten im Zeit-
chungsergebnisse sind von zentraler Bedeutung für das gesamte Gesundheitswesen, denn sie dienen auch als Grundlage für die Untersuchung der Zusammenhänge von Ernährung und einer ganzen Reihe von Erkrankungen. So zeigen sich seit längerer Zeit vor allem Zusammenhänge zwischen dem Konsum bestimmter Lebensmittel und HerzKreislauferkrankungen. Gerade auch deshalb bleibt zu hoffen, dass der Trend sich wieder in Richtung gesündere Ernährung wendet – oder dass zumindest die Defizite falscher Ernährung ausgeglichen werden. Wenn es manchen Menschen nicht gelingen mag, sich gesund zu ernähren, können Vitalstoffe zusätzlich mit einem guten Multivitalstoff-Präparat zugeführt werden. Das kann zwar keine gesunde Ernährung ersetzen, stellt aber eine Möglichkeit dar, dem Körper die lebensnotwendigen Vitalstoffe zuzuführen, ohne die ein Mensch krank wird.
Milch, einschl. Buttermilch
Fleisch und Wurstwaren
Geflügel
Schokolade, Pralinen
15-Jahres-Trend für den Verzehr ausgewählter Lebensmittelgruppen von 1984 bis 2001
Salat oder Gemüse, roh oder zubereitet
Vollkorn, Schwarz-, Knäckebrot Salzige Knabbereien wie gesalzene Erdnüsse, Chips etc.
Kartoffeln
GRAFIK: PHOTODISC, DPNY
7 Quelle: MONICA-/KORA-Projekt Augsburg, Querschnittsstudien 1984/85 und 1999/2001.
AUS DER NATUR
MEDICOM-TIPP
Entzündliche Darmerkrankungen – Vitamine und Mineralstoffe helfen
FOTO: PHOTODISC
ine Darmentzündung geht häufig mit einem Mangel an wichtigen Vitalstoffen einher. Patienten mit Morbus Crohn und Colitis ulcerosa sollten daher einmal jährlich ihr Blutserum auf den Gehalt von Zink, Eisen, dem Eisenspeicherprotein Ferritin und von Vitamin B12 untersuchen lassen, auch dann wenn sie keine akuten Beschwerden haben. Das empfiehlt die „Ärzte Zeitung“. Zudem leiden viele Menschen mit chronisch-entzündlichen Darmerkrankungen auch an einem Mangel an Calcium, Magnesium oder Folsäure. Das ärztliche Fachblatt gibt Tipps, welche Vitalstoffe im Blut kontrolliert werden sollten. Bei 25 bis 80 Prozent der Patienten liegt ein manifester Eisenmangel vor. 10 bis 40 Prozent der von chronisch-entzündlichen Darmerkrankungen Betroffenen fehlt Calcium, und 35 bis 60 Prozent der Patienten mit Morbus Crohn, aber nur fünf Prozent der Colitis-ulcerosa-Kranken haben einen Vitamin-B12-Mangel. 30 bis 65 Prozent der Patienten mit chronisch-entzündlichen Darmerkrankungen haben einen Folsäuremangel. 40 bis 55 Prozent der Patienten mit Morbus Crohn fehlt Zink. Mängel sind außerdem möglich bei den Vitaminen A, E, K und C oder bei Selen. Menschen, die unter entzündlichen Darmerkrankungen leiden, können die Vitalstoffe teilweise nicht richtig aufnehmen oder scheiden sie zu schnell wieder aus. Für Darm-Patienten empfiehlt es sich also auf jeden Fall, zu einem guten und ausgewogenen Multivitalstoff-Präparat zu greifen.
Menschen mit entzündlichen Darmerkrankungen sollten ihre Blutwerte auf Vitamin- und Mineralstoffmangel prüfen lassen.
8
MEDICOM 27. Ausgabe, Dezember 2003
FOTO: BRAND X PICTURES
E
Wer öfter mal „in die Beeren geht”, kann diese hinterher besser finden. Das gilt zumindest für Heidelbeeren. Die sind nämlich besonders gut für die Augen.
Alles klar mit Heidelbeeren Heidelbeeren, Blaubeeren, Bickbeeren – es gibt viele Namen für das leckere Beerenobst, das nur auf der nördlichen Halbkugel zu finden ist. Der Beerensucher weiß, dass die blaue Beere gut schmeckt, und vielleicht ist auch so manchem ihre Heilkraft bekannt.
S
o gilt die getrocknete Blaubeere als besonders wirksames Mittel, um Durchfall zu stoppen. Doch die Frucht des lateinisch als Vaccinium myrtillus bezeichneten Buschgewächses kann noch mehr. Die erstaunliche Wirkung von Heidelbeeren auf die Sehkraft hat man im zweiten Weltkrieg durch Zufall entdeckt. Britische Militärpiloten, die in der Notzeit oft Brote mit Heidelbeermarmelade zu essen bekamen, konnten nachts plötzlich besser sehen und wurden nicht mehr von der Fliegerabwehr geblendet. In den Sechzigerjahren haben dann Wissenschaftler in der Heidelbeere die Anthozyane entdeckt, den Hauptwirkstoff der blauen Farbe in der Heidelbeere. Es wurden Tests und Studien mit französischen Piloten durchgeführt. Die Ergebnisse waren sensationell. Sie bewiesen: Die Anthozyane in der Heidelbeere stärken die Sehkraft und helfen den Augen, gesund zu bleiben. Weitere Studien bewiesen: Wer regelmäßig Anthozyane aus
der Heidelbeere zu sich nimmt, kann bei Dunkelheit besser sehen. Auch bei der von Diabetes verursachten Retinopathie und bei der Makula-Degeneration, einer Erkrankung der Netzhaut, können die blauen Beeren helfen. Mit dem Essen von frischen oder tiefgefrorenen Heidelbeeren allein kann man allerdings keinen medizinischen Erfolg erzielen. Die Anthozyane müssen in extrem hohen Dosierungen verabreicht werden. Für 1 Gramm Wirkstoff muss ein ganzes Pfund wild wachsender Heidelbeeren verarbeitet werden. Da das nächtliche Sehvermögen altersbedingt ab dem 40. Lebensjahr abnimmt, sind Nahrungsergänzungen, die Heidelbeer-Extrakt enthalten, zu empfehlen. Das gilt besonders für Autofahrer, für ältere Menschen sowie für Menschen, die häufig an einem Monitor arbeiten, fernsehen oder lesen. Oft ist der Extrakt in Vitalstoffformulierungen enthalten, die speziell für die Bedürfnisse der Augen konzipiert wurden.
Kostenübernahme für Schwerbehinderte:
Nur für Grundbedürfnisse und medizinische Behandlung
Krankenkassen müssen nur die Kosten für Hilfsmittel für die medizinische Behandlung und für die Befriedigung von Grundbedürfnissen für Schwerbehinderte übernehmen. Dass Autofahrten nicht zu den Grundbedürfnissen zählen, zeigt die Entscheidung des Bundessozialgerichts, dass die Krankenkasse für einen schwerbehinderten Rollstuhlfahrer in der Regel keine Vorrichtung zum Einladen ins Auto bezahlen muss. Bundessozialgericht, Az.: B 3 KR 23/02 R
Keine permanente Überwachung von Säuglingen
IN SACHEN GESUNDHEIT
§
Bringt ein agier aufgrund seiner körperlichen Verfassung, z. B. durch einen Gips, ein erhöhtes Thromboserisiko mit, so kann der Pilot des Charterflugs den Fluggast zurückweisen. Er ist nicht dazu verpflichtet, vorher eingehend zu prüfen, ob die Konstitution des agiers vielleicht doch ausnahmsweise eine Beförderung zulässt. AG Bad Homburg, Az.: 2 C 331/02-19
§
Der Säugling konnte gerettet werden, der Atemstillstand löste jedoch einen Hirnschaden aus. Hierfür besteht jedoch kein Anspruch auf Schmerzensgeld oder Schadenersatz, da auch gelegentliches Spucken die Klinik nicht zur permanenten Überwachung verpflichtet. Oberlandesgericht München, Az.: 1 U 5651/00
Integration steht im Vordergrund:
Behinderte und nicht behinderte Kinder gemeinsam unterrichten
Das Sozialamt muss die Kosten für einen Unterrichtsbegleiter für ein behindertes Kind, das auf einer Grundschule für Nichtbehinderte unterrichtet wird, übernehmen. Dies wurde im Falle eines körperlich und geistig behinderten Kindes entschieden, dessen Eltern die Erlaubnis der Schulbehörde hatten, ihr Kind bei der Regelgrundschule anzumelden. Auch wenn diese Kosten auf einer Sonderschule nicht anfallen
• GERICHTSURTEILE IN SACHEN GE
FOTO: PHOTODISC
Kein Flug bei Thromboserisiko
GERICHTSURTEILE
würden – die integrative Unterrichtung behinderter und nicht behinderter Kinder steht hier im Vordergrund. OVG Rheinland-Pfalz,Az.: 12 A 10410/03
Allergieauslösende Bäume:
Nicht jeder kann einfach gefällt werden Kann ein Hausbesitzer beweisen, dass ein bestimmter, in der Nähe seines Grundstücks stehender Baum Allergien bei ihm auslöst, so darf dieser geschlagen werden, auch wenn der Baum wegen seiner Stärke eigentlich nicht gefällt werden dürfte. Befinden sich jedoch mehrere allergieauslösende Bäume in der Umgebung, kann kein Anspruch auf die Fällung des Baumes erhoben werden. OVG NRW, Az.: 8 A 5373/99
Löst ein bestimmter Baum eine Allergie bei ihm aus, so darf ein Hausbesitzer, der in der Nähe wohnt, dessen Fällung veranlassen – wenn er die Allergie beweisen kann.
ILLUSTRATION: NILS WASSERMANN
GERICHTSURTEILE IN SACHEN GESUNDHEIT •
Aus einem Urteil des Oberlandesgerichts München geht hervor, dass Kliniken nicht zur permanenten Überwachung von gesunden Säuglingen verpflichtet sind. In einem aktuellen Fall hatte ein Neugeborener am Tage der Geburt keine Auffälligkeiten, außer gelegentlichem Spucken, gezeigt. Am darauf folgenden Tag atmete der Junge nicht mehr, als die Krankenschwester nach 20-minütiger Abwesenheit zurückkam. GERICHTSURTEILE IN SACHEN GESUNDHEIT • GERICHTSURTEILE IN SACHEN GESUNDHEIT • GERICHTSURTEILE IN SACHEN GESUNDHEIT
Eine Haftung für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität können wir nicht übernehmen.
MEDICOM 27. Ausgabe, Dezember 2003
9
MEDICOM informiert
MEDICOM informiert
MEDICOM informiert
INFORMATIONEN FÜR KUNDEN DER MEDICOM PHARMA AG
r t e i m r o f in
Keine Chance für Salmonellen Sommer, Sonne, Hitze: Deutschland erlebte in diesem Jahr eine ungewöhnliche Schön-Wetter-Periode. Doch dieser „JahrhundertSommer“ hatte auch seine Schattenseiten. Denn bestimmte Krankheitserreger wie Salmonellen fanden gerade bei diesen hohen Temperaturen optimale Wachstumsbedingungen.
S
o machte denn auch ein Polterabend in Appenheim Schlagzeilen, bei dem gleich 70 Gäste durch den Verzehr infizierter Mettbrötchen an Salmonellose erkrankten.
Die Salmonellose – medizinisch: Salmonella enteriditis – äußert sich entsprechend mit plötzlichem Unwohlsein, heftigen Bauchschmerzen, wässrigen Durchfällen sowie Erbrechen und Kopfschmerzen; manchmal kommt auch Fieber hinzu. Die Brech-Durchfälle hören zumeist nach 2 bis 3 Tagen auf, spätestens jedoch nach einer Woche. So unangenehm die Symptome 10
MEDICOM 27. Ausgabe, Dezember 2003
27. AUSGABE, DEZEMBER 2003
Bei kleinen Kindern und Senioren ist dies auf die verminderte Produktion von Magensäure zurückzuführen, die beim gesunden Erwachsenen einen Großteil der Keime abtötet. Abwehrgeschwächte und Schwangere sind wegen ihrer schwachen Gesamtkonstitution empfänglicher für Salmonellen-Infektionen.
Wie es zur Infektion mit Salmonellen kommen kann ... Jährlich werden deutschen Gesundheitsbehörden mehr als 70.000 Fälle der meldepflichtigen Salmonellose mitgeteilt. Experten vermuten jedoch, dass die Dunkelziffer, d. h. die Zahl der Fälle, die nicht als Salmonellosen erkannt oder gemeldet werden, etwa 10-mal so hoch liegt. Denn Infektionsmöglichkeiten gibt es viele: Bestimmte Tierarten sind zumeist geringfügig mit Salmonellen infiziert. Diese Tiere dienen den Salmonellen als Wirt – also als Lebensraum –, sie selbst zeigen aber keine Krankheitssymptome. Als Wirtstiere kennt man Geflügel, Schweine, Rinder und Wild. Ein potenzielles Risiko besteht somit bei allen rohen Fleischarten (z. B. Tartar) und Frischwurstwaren (Zwiebelmettwurst), die von diesen Tieren gewonnen wurden. Infiziert können auch andere von diesen Tieren stammende Lebensmittel sein, wie z. B. rohe Eier und Rohmilch, sowie die aus diesen Rohstoffen hergestellten Produkte (z. B. Mayonnaise, Tiramisu, Softeis). Problematische Lebensmittel sind auch Gewürze, Tee, getrocknete Pilze, gekeimte Sprossen sowie Schalen- und Krustentiere und Sushi. Wird bei diesen Lebensmitteln jedoch penibel auf Hygiene und auf die richtige Zubereitung geachtet, geht von ihnen keine Gefährdung aus. Erst falscher Umgang mit diesen Lebensmitteln macht Salmonellosen möglich. Bedeutsam bei der Abwehr von Salmonellen ist die Aufrechterhaltung der so geFOTO: USDA/ScienceSource/OKAPIA
Wie schaden uns Salmonellen? Salmonellen sind stäbchenförmige Bakterien, die nach dem amerikanischen Bakteriologen Daniel E. Salmon (1850-1914) benannt wurden. Sie können sich sowohl unter Sauerstoffzufuhr (aerob) als auch bei Luftabschluss (anaerob) vermehren, dabei benötigen sie aber Temperaturen zwischen 10° C und 47° C. Obwohl man heute weit mehr als 2.000 Arten von Salmonellen kennt, wird die bei uns übliche Salmonellen-Erkrankung vor allem von zwei Erregern hervorgerufen: Salmonella enteritidis und Salmonella typhimurium. Die Salmonellen werden über infizierte Lebensmittel oder über das Trinkwasser aufgenommen. Sie verursachen dann im Dünndarm oder im oberen Dickdarm eine lokale Infektion, indem sie in die Zellen der Darmschleimhaut eindringen und diese durch die Freisetzung von Toxinen (Giftstoffen) schädigen.
MEDICOM informiert
In heißen Sommern leider sehr verbreitet: Die Salmonellen lieben die Wärme und können sich in Fleisch, Milch und Eiern vermehren.
für die Betroffenen sind – wenn streng auf einen Ausgleich der Flüssigkeitsverluste geachtet wird sowie auf den Mineralhaushalt, genesen die Patienten zumeist rasch. Bei bis zu 5 % aller Erkrankungen kann die Salmonellose allerdings einen schweren Verlauf nehmen mit hohem Fieber, Kollaps und Organschäden oder sogar tödlich enden. Zu den Risikogruppen gehören kleine Kinder, Schwangere, ältere Menschen und Abwehrgeschwächte. Während beim gesunden Erwachsenen etwa 10.000 bis 1.000.000 SalmonellenKeime notwendig sind, um eine Erkrankung hervorzurufen, reichen bei Risikopatienten schon bis zu 100 Keime aus.
MEDICOM informiert
nannten Kühlkette, also der durch-gängigen Kühlung vom Hersteller des Lebensmittels über die Lagerung beim Händler und im Haushalt bis hin zum endgültigen Verzehr. Nur bei dauerhafter, ausreichender Kühlung (unter 10 °C, am besten 6 °C) wird die Vermehrung der Salmonellen unterbunden. Werden rohe salmonelleninfizierte Lebensmittel dagegen ungekühlt aufbewahrt, verdoppelt sich die Zahl der Bakterien alle 15 bis 20 Minuten. Beim Grillfest oder auf dem Büfett im aufgeheizten Partyraum kann so über mehrere Stunden hinweg eine erhebliche Salmonellen-Belastung entstehen. Auch Einfrieren tötet die Salmonellen nicht ab, sondern inaktiviert sie nur vorübergehend. Auftauen von Tiefkühlgut sollte daher niemals im Warmen, sondern immer im Kühlschrank erfolgen, da sich die Salmonellen ansonsten stark vermehren.
MEDICOM informiert
… und
wie man sich dagegen schützen kann
Der beste Schutz gegen Salmonellose sind Hygiene und kühle Lagerung – nicht nur im Sommer, sondern während des ganzen Jahres. Denn Salmonellen sind nicht an Geruchs-, Geschmacks- oder sonstigen Veränderungen des Lebensmittels zu erkennen. Auch gibt es keine Impfung gegen Salmonellen, und eine überstandene Salmonellen-Erkrankung immunisiert den Körper nicht gegen weitere Infektionen. In der Küche sollte unbedingt auf penible Händehygiene geachtet werden – und Geschirrtücher und Spüllappen sollten so oft wie möglich gewechselt werden. Benutzte Küchengeräte sollten möglichst sofort gründlich mit heißem Wasser gereinigt werden. So verhindert man eine mögliche SalmonellenVerunreinigung von an sich unproblema-
Himalaya-Salz: ohne Vorteile Das so genannte Himalaya-Salz wurde durch das Buch „Wasser und Salz – Urquelle des Lebens“ als angeblich gesundheitsförderlich bekannt und hielt daher auch Einzug in Apotheken, Reformhän und Naturkostläden.
D
ie DGE (Deutsche Gesellschaft für Ernährung) weist jedoch in ihrer Zeitschrift „info“ (Ausgabe 04/03) darauf hin, dass das Himalaya-Salz keine gesundheitlichen Vorteile gegenüber dem üblichen Speisesalz (chemisch: Natriumchlorid) aufweist. Im Gegenteil: Die DGE hält viele Behauptungen des Buches für nicht wissenschaftlich belegt oder sogar für haltlos. Die Autoren beschreiben Himalaya-Salz (auch Kristallsalz genannt) als besonders wertvoll, da es aus einem der Urmeere stammt, 250 Mio. Jahre alt ist und angeblich eine breite Palette an Mineralstoffen enthält. Haushaltssalz (Natriumchlorid) kritisieren die Autoren dagegen als giftige und aggressive chemische Substanz. Jod und Fluor, wie sie heute in vielen Haushaltssalzen enthalten sind, werden außerdem als „hochtoxisch“ bewertet. Diese Behauptungen sind aber nicht haltbar. Auch Himalaya-Salz besteht zu 97 % aus Natriumchlorid, so DGE-info. Natrium kann somit keine schwerwiegende Schädigung hervorrufen, ansonsten müsste diese auch durch das HimalayaSalz erzeugt werden. Die Empfehlung der
Himalaya-Salz-Befürworter, Fertiggerichte leicht mit Himalaya-Salz nachzuwürzen, um die schädigende Wirkung des Natriumchlorids wieder aufzuheben, ist somit paradox und angesichts des ohnehin hohen Salzverzehrs der deutschen Bevölkerung abzulehnen. Da Natriumchlorid im Himalaya-Salz den Hauptgewichtsanteil ausmacht, ist laut DGE-info weiterhin anzuzweifeln, dass das Kristallsalz wirklich nennenswert zur Versorgung mit Mineralstoffen – einmal abgesehen von den Stoffen Natrium und Chlor – beitragen kann. Auch die anderen Behauptungen der Buchautoren erweisen sich als nicht haltbar: Sowohl Natrium als auch Chlorid üben im menschlichen Körper durchaus wichtige Funktionen aus, vor allem bei der Aufrechterhaltung der Flüssigkeitsverteilung in den Geweben. Von einer bedarfsgerechten Versorgung mit Speisesalz (6 g pro Tag) geht daher keine Gefährdung aus. Fluor spielt eine wichtige Rolle bei der Zahngesundheit, und durch die heute übliche Jodierung des Speisesalzes konnte die Anzahl jodmangelbedingter Schilddrüsenerkrankungen reduziert werden. Auch
MEDICOM informiert
tischen Lebensmitteln (Gemüse, Obst). Rohe bedenkliche Lebensmittel (Tartar, Sushi) oder aus rohen Zutaten hergestellte Speisen (Tiramisu, Mayonnaise) sollten immer am gleichen Tag verwendet werden, an heißen Tagen aber am besten ganz gemieden werden. Fleisch, vor allem Hackfleisch, bitte immer gut durchbraten, am besten mindestens 10 Minuten bei über 70 °C. Beim Garen in der Mikrowelle sollten lange Garzeiten gewählt und zurückbleibende „kalte Nester“ in den Lebensmitteln verhindert werden. Warme Speisen sollten nicht lange warm gehalten werden, sondern besser schnell abgekühlt und bei Bedarf wieder erhitzt werden. Und das Wichtigste, nicht nur an heißen Tagen: Lebensmitteleinkäufe immer sofort im Kühlschrank verstauen und dort gekühlt lagern und erst unmittelbar vor dem Verzehr herausnehmen – dann haben Salmonellen keine Chance.
gegen die Verwendung jodierter oder fluoridierter Speisesalze bestehen somit keine gesundheitlichen Bedenken. Zu kritisieren sind die Vertreter des Himalaya-Salzes aber besonders deshalb, weil sie der kristallinen Sole, einem bestimmten Aufguss des Himalaya-Salzes, eine positive medizinische Wirksamkeit bei Bluthochdruck nachsagen. Seit langem ist aber bekannt, dass bei mindestens 50 % aller Hypertoniker eine erhöhte Salzzufuhr das Bluthochdruckrisiko noch verstärkt. Bluthochdruckpatienten wird daher generell empfohlen, möglichst wenig, aber keinesfalls mehr als 6 g Kochsalz (Natriumchlorid) pro Tag zu verzehren. Aufgrund des hohen Natriumchloridgehalts des HimalayaSalzes ist Bluthochdruckpatienten deshalb auch vom Konsumieren der Sole dringend abzuraten. Zweifelhaft ist außerdem die angebliche Wirkung der Kristallsalz-Sole hinsichtlich des Säure-Basen-Haushalts. DGE-info weist darauf hin, dass der menschliche Organismus über effektive Puffersysteme verfügt, die ernährungsbedingte Schwankungen im Säure-BasenHaushalt ausgleichen und die kristalline Sole somit überflüssig machen. FOTO: DPNY
MEDICOM informiert
MEDICOM 27. Ausgabe, Dezember 2003
11
Im Land des Lächelns lebt man länger
Japaner haben die höchste Lebenserwartung der Welt. In diesem Jahr übersteigt die Zahl der Hundertjährigen erstmals die Marke von 20.000. Frauen werden in Japan im Durchschnitt 85 Jahre, Männer 78 Jahren alt. Auch die älteste Frau der Welt, die erst kürzlich gestorbene Japanerin Kamato Hongo, wurde 116 Jahre alt. Die ältesten Zwillinge der Welt, die 1892 ebenfalls in Japan geborenen Kin Sang und Gin San, geben auf die Frage, warum sie glauben, so alt und noch so gesund zu sein, die Antwort: Lachen und die richtige Ernährung.
30
35
40
45
50
Mali
Malawi
55
60
Sudan
65
70 Brasilien
FOTO: PHOTODISC
Alter in Jahren
Sierra Leone
Botswana
Südafrika
Indien
China
K
ulturschock Japan: So beschreiben viele ihren ersten Eindruck vom Land der aufgehenden Sonne. Die japanische Kultur ist für uns westliche Menschen nur sehr schwer verständlich. Viele Vorurteile haben diejenigen, die noch nicht dort waren. Japaner lächeln ständig, leben auf engstem Raum zusammen, sind Technikfanatiker, arbeiten bis zum Umfallen und im Rentenalter noch weiter und vertragen keinen Alkohol. Japaner rasen in hypermodernen, enorm schnellen Zügen durch ihre futuristischen Metropolen und finden dennoch die Zeit, sich vor jeder Tür die Schuhe auszuziehen. Wir wissen von buddhistischen Klöstern, schintoistischen Schreinen, von ebenso geheimnisvollen wie wirksamen Heilmethoden, und wir bringen auch einige obskure Riten, wie das essen lebendiger Tiere, mit dem alten und dem neuen Japan in Verbindung. Japaner denken und handeln anders als wir, und gerade das macht ihre Kultur so interessant für uns. Wir sind der Faszination Nippons in vielen Bereichen erlegen, so dass vieles Japanische Einzug in unseren Kulturkreis gehalten hat: die japanische Küche, die japanischen Religionen, die Heilkunst, die Kampfkunst, die Gartengestaltung, die Architektur und vieles mehr. Ihre Kultur scheint auch großen Einfluss auf die Lebenserwartung der Japaner zu haben: Sie leben gesünder und länger als wir. Für die derzeit heranwachsende Generation gilt das nicht gleichermaßen, denn viele haben sich von der gesunden Lebensweise ihrer Eltern verabschiedet. Die gute Gesundheit der Japaner kann keine genetischen Ursachen haben, denn Japaner, die in den USA aufgewachsen sind und die dortige Lebens- und
Esskultur übernommen haben, leiden unter genau den gleichen Erkrankungen wie die Amerikaner. Das sind zum großen Teil die typischen Zivilisationskrankheiten der westlichen Welt, wie beispielsweise Herz- und Darmerkrankungen. Die Langlebigkeit im Land des Lächelns wird den Japanern demzufolge nicht in die Wiege gelegt, sie muss vielmehr in der Kultur begründet liegen. Die Quelle der japanischen Kultur ist die Tradition. Japaner kehren immer wieder in die Vergangenheit zurück, um sich zu vergewissern, wer sie sind. Alt hergebrachte und oft über Jahrhunderte unveränderte Zeremonien prägen zwar den Alltag nicht unmittelbar, aber doch das Leben eines jeden Japaners, seien es die Teezeremonien, die traditionellen Sportarten wie Aikido und Bogenschießen, die Religionen oder das Theater und das Puppenspiel. Die japanische und die chinesische Kultur sind übrigens – trotz vieler vermeintlicher Ähnlichkeiten für uns Europäer – völlig unterschiedlich. Viele japanische Traditionen haben zwar ihren Ursprung in der chinesischen, der indischen oder der koreanischen Kultur, doch sie haben sich im Laufe von Tausenden von Jahren mit anderen Einflüssen vermischt und weiterentwickelt. Das gilt ebenso für die Sprache, die nur noch in den Schriftzeichen der chinesischen ähnlich ist. Die Niederlage im zweiten Weltkrieg zwang Japan, sich dem Westen zu öffnen; auch das hat großen Einfluss auf die japanische Kultur genommen. Trotz all der modernen westlichen Attribute ist es falsch, die Japaner als westlich zu
bezeichnen. Auf den folgenden Seiten wollen wir versuchen, einige Teilbereiche dieser jahrtausendealten Kultur zu beschreiben. Uns geht es dabei vor allem darum, herauszufinden, warum die Japaner gesünder sind als wir. Vieles muss daher leider unangesprochen bleiben. Nehmen Sie´s bitte mit der Gelassenheit der buddhistischen Mönche.
Ki, die universelle Lebensenergie Die Japaner orientieren sich an der Lebensenergie Ki (sprich: Tschie). Ki (chinesisch Qi), das man als strömende Lebenskraft beschreibt, ist überall in der Natur und im Universum vorhanden und zeigt sich in allem Lebendigen in Form von Veränderung und Bewegung. Gemäß dieser Vorstellung ist jeder Lebensvorgang, jede Organfunktion Ausdruck des Wirkens und der Bewegung des Ki. Ohne Ki gibt es keine Bewegung, keinen Gedanken, keine Emotionen und kein Leben. Und obwohl Ki alles durchdringt und alles umfasst, lässt es sich nicht konkret beschreiben oder definieren. Bildlich gesehen kann man sich das Ki wie einen ständig fließenden Wasserfall vorstellen, der alles umgibt und alles durchdringt. Auch in der traditionellen japanischen und chinesischen Medizin verwendet man den Begriff Ki, um die Lebensenergie im Körper zu beschreiben. So kommt der Begriff auch in den Namen der Heilmethoden wie z. B. Reiki vor. Auf der Beherrschung und Lenkung des Ki beruhen auch alle östlichen Meditations- und Kampftechniken wie Tai Chi Chuan oder Aikido. Über Ki werden Sie im folgenden Text noch einiges lesen.
Länder mit der höchsten Lebenserwartung 77 Großbritannien
USA
78
79
Niederlande
Belgien
Neuseeland
Deutschland
Österreich
Spanien
80
81
Schweiz
San Marino
Frankreich, Italien
Australien, Schweden
Japan 81,4 13
Jenseits der Grenzen des Verstandes
I
n Japan koexistieren friedvoll drei große Religionen: der Zenbuddhismus, der Schintoismus und, als kleinste religiöse Gruppierung, das Christentum. Viele Japaner haben einen sehr pragmatischen Bezug zu diesen Religionen entwickelt und gehören oft den beiden verbreitetsten Glaubensrichtungen gleichzeitig an, ohne dies auch nur im geringsten als widersprüchlich zu empfinden. Festliche Anlässe wie Hochzeiten und Jubiläen werden vor allem schintoistisch gefeiert, und auch Bitten um Gesundheit, Glück und Wohlergehen werden in schintoistischen Schreinen vorgebracht. Begräbniszeremonien werden dagegen meist nach buddhistischem Ritus abgehalten, da der Buddhismus mit seiner Verheißung von Wiedergeburt besonders tröstlich und bestärkend wirkt. Dies spricht für einen positiven, am Nutzen orientierten Umgang der Japaner mit Religion. Die Gläubigkeit kann einer der Gründe für ihre Langlebigkeit sein, denn auch in unserem Kulturkreis ist bekannt, dass religiöse Menschen länger gesund bleiben. Lesen Sie hier eine kurze
Darstellung der beiden japanischen Hauptreligionen. Mehr zum Thema Buddhismus lesen Sie auf Seite 20/21.
Zenbuddhismus Zen (sprich: senn, japanisch für: Versenkung) ist die japanische Richtung des Buddhismus. Der Buddhismus kam aus China nach Japan. Zen versteht sich als die Konzentration auf das Wesentliche, nämlich auf die Meditation und das achtsame Handeln im Alltag. Der Zenbuddhismus verzichtet auf Theorien und Dogmen. Der Legende nach entstand diese besondere Form der Lehre aus der historischen Lehre des Buddhismus, als Buddha eine Predigt hielt und von seinen Schülern mit Fragen bestürmt wurde. Er lächelte nur und hielt schweigend eine Blüte hoch. Damit versinnbildlichte er, dass es nicht um Theoretisches geht, das intellektuell zu vermitteln ist, sondern um das Wesentliche: die Achtung und den Respekt vor dem Wesen der Dinge und Lebewesen: die Liebe. Nur ein Schüler begriff, was sein Meister damit sagen wollte, und wurde erleuchtet.
Diese „Herz-zu-Herz-Kommunikation“ ist im Zen sehr wichtig, schriftliche Überlieferungen spielen keine solch entscheidende Rolle wie in anderen Richtungen des Buddhismus. Der Zenbuddhismus zeichnet sich durch eine Spiritualität aus, die sehr alltagsverbunden ist. So ist das Tun an sich bedeutsam, weil es uns die Möglichkeit gibt, ganz darin aufzugehen und auf diese Weise das Einssein mit allem zu erfahren. Daher gelten die Teezeremonie oder das Bogenschießen auch als Meditation. Eine andere Form der Versenkung ist die Meditation über paradoxe Rätsel, die nicht mit dem Verstand zu lösen sind, sondern – ganz im Gegenteil – dem Verstand seine Grenzen aufzeigen sollen. Ein Beispiel: Wie hört sich das Klatschen der linken Hand an?
Schintoismus Die ursprüngliche Religion der Japaner ist der Schintoismus, der „Weg der Götter“. Es gibt 800 Myriaden Gottheiten, die verehrt werden. Schintoisten verehren die Natur und die Geister ihrer Ahnen. Diese Religion hat keine Gründer, ihre Anfänge liegen in der japanischen Vorzeit. Es gibt keine offiziellen heiligen Schriften und kein Lehrsystem. Die schintoistische Praxis besteht in Opfergaben und Riten vor öffentlichen Schreinen oder privaten Hausaltären. Diese sollen die Ahnen und die Geister gnädig stimmen. Der Schintoismus fordert Pflichttreue und Selbstbeherrschung.
FOTOS: PHOTODISC, DIGITALVISION, TONY STONE
Glaubt man US-amerikanischen Forschern, dann sind die Buddhisten die glücklicheren Menschen. Studien ergaben: Buddhisten lassen sich weniger schnell schockieren oder überraschen und regen sich seltener auf. Das soll an der Meditation liegen.
14
„
Für die Teezeremonien wird ein spezieller Tee verwendet, der Matchatee. Er wird unter besonderen Umständen kultiviert und auf andere Weise zubereitet als normaler grüner Tee.
as Ritual der japanischen Teezeremo-
nie hat seinen Ursprung in der Kultur der Zen-Klöster. Während der etwa vierstündigen Teezeremonie (chadô) wird in der Gegenwart des Gastes in ritueller Form grüner Tee zubereitet und serviert. Zu einer vollständigen Teezeremonie gehören eine kleine Mahlzeit und das zweimalige Servieren von Tee. Es ist die Aufgabe des Gastgebers, eine Atmosphäre zu schaffen, in der seine Gäste einen ästhetischen und sinnlichen Genuss sowie geistigen Frieden erleben können. Die tiefgründige Schönheit sehr einfacher Dinge, wie sanftes Kerzenlicht, der Klang des Wassers oder das Glühen eines Holzfeuers, sollen dabei helfen. Die Zeremonien werden in kleinen, hübsch gestalteten Räumen und Gärten von Teehän durchgeführt. Nicht nur der Gastgeber, sondern auch die Gäste einer Teezeremonie müssen mit der Demonstration von Bescheidenheit ihren Teil zur Harmonie beitragen. Der Teeweg ist einer der Wege des Zenbuddhismus, den Menschen in Einklang mit der Natur zu bringen. Menschen auf dem Teeweg lernen, sich in ihrer Lebenszeit auf die wesentlichen Dinge zu konzentrieren. Auf die Weise, wie sie dem Gast die Schale mit Tee reichen und wie dieser sie entgegennimmt, setzen sie gegen Unordnung und Wirrnis eine lebendige Harmonie. Die Philosophie des Teeweges ist eine Synthese von östlicher Kultur und religiösen Traditionen. Ein Grund, weswegen Mönche mit Tee meditieren, ist auch dessen anregende Wirkung. Er hält bei den oft langen
FOTOS: PHOTODISC
“
Sen nô Rikyû (1522 bis 1591) Vollender des Teeweges
– der Teeweg
D
In meinen Händen halte ich eine Schale Tee. Seine grüne Farbe ist ein Spiegel der Natur, die uns umgibt. Ich schließe meine Augen, und tief in mir finde ich die grünen Berge und das klare Wasser der Quellen. Ich sitze allein, werde still und fühle, wie all dies ein Teil von mir wird.
Meditationen wach. Für die Teezeremonie wird ein grüner Pulvertee verwendet, der Matchatee. Der Tee wird mit heißem, aber nicht kochendem Wasser aufgegossen und mit einem pinselähnlichen Bambusbesen ein paar Sekunden lang geschlagen, bis das Pulver sich auflöst und an der Oberfläche ein grünlicher Schaum entsteht. Der Schaum verleiht dem Tee sein besonderes Aroma. Anders als beim Trinken des gebrühten Tees werden beim Trinken dieses Pulvertees alle in den Blättern enthaltenen heilsamen Wirkstoffe, einschließlich des Koffeins, ganz aufgenommen. Der Matchatee hat einen starken Geschmack und wirkt sehr anregend. Die lange Tradition des Trinkens von grünem Tee ist mit Sicherheit ein Aspekt der guten Gesundheit der Japaner. Denn – einmal von seinen meditativen Qualitäten abgesehen – ist der grüne Tee schon immer als Heilmittel gegen viele körperliche Leiden bekannt gewesen. Die wissenschaftliche Forschung weiß schon seit längerer Zeit, dass seine Inhaltsstoffe gegen die verschiedensten Erkrankungen wie Krebs, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Infektionen, Magenerkrankungen und Karies wirken. Die wertvollen Inhaltsstoffe des grünen Tees sind auch in hochwertigen Multivitalstoffpräparaten enthalten.
Neue Forschungsergebnisse Mechanismus der Krebsvorbeugung entschlüsselt Wie grüner Tee die Krebsentstehung vermindert, das haben amerikanische Wissenschaftler jetzt herausgefunden. Ein Botenprotein wird dabei von den Inhaltsstoffen des grünen Tees blockiert. Zahlrei-
che Studien hatten bereits gezeigt, dass grüner Tee bestimmten Krebsarten vorbeugen kann. Wie das funktioniert, haben die Wissenschaftler um Christine Palermo von der Universität von Rochester in einer neuen Studie herausgefunden, die in der Fachzeitschrift „Chemical Research of Toxicology“ veröffentlicht wurde. Um hinter den Wirkungsmechanismus zu kommen, untersuchten die Forscher verschiedene Inhaltsstoffe eines TeeExtraktes und identifizierten zwei hauptverantwortliche Bestandteile und ihre Strategie. Wenn krebserregende Stoffe wie Tabakrauch oder Dioxin in den Körper gelangen, wird ein bestimmtes Eiweißmolekül aktiviert, das die krankmachende Wirkung dieser Stoffe im Körper hervorruft. Zwei Substanzen aus dem Tee-Extrakt fangen diesen Botenstoff ab und verhindern so die Entstehung von Krebs. Die beiden Substanzen, EGCG und EGC, finden sich außer im grünen Tee auch in Weintrauben und im Rotwein. Diese sekundären Pflanzenstoffe haben eine hohe antioxidative Wirkung und machen Freie Radikale unschädlich. Zahlreiche Studien belegten bereits, dass in Ländern, in denen regelmäßig viel grüner Tee getrunken wird, weniger Menschen an Krebs erkranken. Bisher nahm man an, dass die krebsvorbeugende Wirkung ausschließlich auf der antioxidativen Wirkung beruht. Die vorliegende Studie beweist jedoch, dass grüner Tee noch über weitere und zusätzliche Wirkungsmechanismen gegen Krebs verfügt. In den westlichen Ländern mag man oft den leicht herben Geschmack des grünen Tees nicht. Wer grünen Tee nicht mag oder nur sehr selten trinkt, aber dennoch von dessen krebsvorbeugenden Eigenschaften profitieren will, der kann zu Nahrungsergänzungen greifen, die
15
FOTOS: DIGITALVISION
Das Ki, die Lebensenergie, die durch die Meridiane des Körpers fließt, wird durch Berührung und mit sanftem Druck positiv beeinflusst.
– asiatische Medizin Die Philosophie
Shiatsu: sanfter Druck gegen den Schmerz
In der asiatischen Medizin trennen Ärzte den Körper nicht vom Geist. Der Mensch wird in der Wechselbeziehung zwischen Körper und Seele betrachtet. Gesundheit stellt ein Gleichgewicht der Kräfte dar, während Krankheit eine Störung dieser Ausgeglichenheit ist. In einem gesunden Organismus durchströmt die Lebensenergie Ki (auch Qi, gesprochen: Tschie) ungehindert den Körper auf unsichtbaren Kanälen. Gerät dieser Fluss ins Stocken, wird also das Gleichgewicht gestört, zum Beispiel durch Stress, falsche Ernährung, Klimaeinflüsse oder Emotionen, dann wird der Mensch krank. Möchte man Krankheiten heilen, so muss man „entstören“, d. h. die Ordnung wiederherstellen. Mit Hilfe von verschiedenen Techniken wie zum Beispiel Shiatsu (japanische Druckmassage, Akupressur) oder Reiki (Handauflegen) kann man den Energiefluss wieder in Gleichklang bringen. Lesen Sie hier über die Grundprinzipien dieser beiden japanischen Heilkünste. Japaner nutzen diese Techniken auch vorbeugend, damit es gar nicht erst zu Krankheiten kommen kann.
Geplagt von Kopfschmerzen drücken wir „automatisch“ mit den Fingern auf die Schläfen oder massieren die Stirn. Und meist tritt dann auch Erleichterung ein. Ohne es zu wissen wenden wir dabei eine Technik an, die ihren Ursprung in Asien hat: Shiatsu. Shiatsu ist eine seit über 2.000 Jahren bekannte Form der Druckmassage, die in Selbst- oder Fremdbehandlung ausgeübt werden kann und auf sanfte Art und Weise Beschwerden und Krankheiten lindert. Durch Shiatsu können sich Blockaden auflösen, sowohl im körperlichen als auch im seelischen Bereich. Solche Blockaden können sich sowohl als Verspannungen, Bewegungseinschränkungen oder schmerzende Bereiche im Körper zeigen als auch als Niedergeschlagenheit oder innere Anspannung. Die Harmonisierung des Energieflusses führt zu Entspannung und innerer Ruhe sowie zu einer verbesserten Körperwahrnehmung und zu einem besseren Körpergefühl. Shiatsu dient der Erhaltung der Gesundheit und regt bei Beschwerden die Selbstheilungskräfte an.
Extrakte des grünen Tees enthalten.
Östliche Lehren verstehen Krankheit auch als Reinigung, als Entwicklungsmöglichkeit des Individuums. So betrachtet wird der Krankheit auch die Schwere und die Unausweichlichkeit genommen. Wer Krankheit als Entwicklungsprozess versteht, kann sie annehmen und sie, wenn es an der Zeit ist, auch wieder ablegen. Eine sehr gesunde und weise Einstellung.
16
Reiki: Heilen durch Handauflegen Wie Shiatsu, so beseitigt auch Reiki Störungen im Energiefluss in den so genannten Meridianen. Durch jahrhundertelange Beobachtung haben die Chinesen ein „Kanalsystem“ mit 12 Hauptleitbahnen (Meridianen) ausgemacht, die alle
inneren Organe miteinander verbinden. Die Japaner haben diese Lehre von den Chinesen übernommen. Sechs Kanäle verlaufen von oben nach unten, sechs entgegengesetzt von unten nach oben. Zahlreiche weitere Meridiane verbinden die Kanäle untereinander. Vorstellen kann man sich das ähnlich wie Blutbahnen, nur dass in den Meridianen kein Blut fließt, sondern dass dort die Zirkulation der Energie – des Ki – stattfindet. Mittlerweile ist auch die moderne Wissenschaft in der Lage, Meridiane mit Hilfe von bioelektrischen Geräten zu messen. Reiki nimmt wie Shiatsu Einfluss auf Störungen im Energiefluss. Der Therapeut legt dazu seine Hände in bestimmter Reihenfolge auf die Energiepunkte der Meridiane. Wie Reiki genau wirkt, ist nicht bekannt. Es gibt aber diverse Erklärungen. Fest steht, dass beim Auflegen der Hände die meisten Menschen eine wohltuende Wärme verspüren, die sich schließlich im ganzen Körper ausbreitet. Diese Wärme aktiviert die Selbstheilungskräfte im Körper und vermag so, Krankheiten zu heilen. Reiki wird nicht nur als Behandlungsmethode verstanden, sondern auch als spiritueller Weg. Dessen Regeln lauten wie folgt.
Gerade heute ärgere dich nicht. Gerade heute sorge dich nicht. Ehre deine Eltern, deine Lehrer und die Älteren. Verdiene dein Brot ehrlich. Empfinde Dankbarkeit für alles Lebendige.
– Geist und Körper vereint Heilen und kämpfen (beschränkt auf die Kampftechnik, nicht auf deren Anwendung) stehen in japanischer Sichtweise zueinander wie Tag und Nacht. Beides ist, vertieft betrachtet, von gleicher Natur. Es bedingt sich gegenseitig, eins kommt ohne das andere nicht aus. Aikido, Judo und Kendo sind so genannte Zen-Kampfkünste. Übungen wie Aikido oder der Schwertkampf Kendo stehen in der Tradition der berühmten Samurai. Wir möchten Ihnen hier die reine Selbstverteidigungs-Kunst Aikido vorstellen.
Aikido, der Weg der Harmonie Ai-Ki-Dô ist ein Weg (Dô), die Lebensenergie (Ki) in Harmonie (Ai) zu bringen, deren Störung die Japaner als Ursache von Erkrankungen sehen. Aikido wird oft auch als „Lehre des harmonischen Weges“, oder „Kunst der gewaltlosen Selbstverteidigung“ bezeichnet. Der Sport lehrt den achtsamen Umgang mit dem anderen, der als Partner für die eigene Entwicklung dient. Der Trainingspartner bringt seine Energie in Form eines Angriffes ein. Diese Energie nimmt
„
Gewaltlosigkeit ist für unsere Gattung Gesetz, so wie Gewalt für das Tier Gesetz ist. Der Geist des Tieres ist unterentwickelt, und das Tier kennt kein anderes Gesetz als das der physischen Kraft. Dem Menschen gebietet seine Würde, einem höheren Gesetz, der Kraft des Geistes zu folgen.
Ueshiba Morihei Begründer des Aikido
der Angegriffene an und neutralisiert sie durch bestimmte Techniken. Erlösung aus dieser tänzerisch anmutenden Bewegung wird dem Angreifer dadurch zuteil, dass er sich der Führung des Verteidigers hingeben und sich letztendlich fallen lassen muss. Aikido beinhaltet Elemente verschiedener anderer japanischer Kampfsportarten. Die Philosophie des Aikido wendet sich jedoch gegen jede Form von Gewalt. Es ist eine Art der Selbstverteidigung, die Rücksicht nimmt auf das Recht der körperlichen Unversehrtheit eines jeden Menschen – auch auf die eines Angreifers. Im Aikido werden keine „Wettkämpfe“ durchgeführt. Es gibt keine Gegner, die es zu besiegen gilt. Es handelt sich immer um Partner, die einen gemeinsamen Weg beschreiten und sich dabei gegenseitig helfen. Eine solche Sichtweise führt zu einem geringeren Aggressionspotenzial und einem schöneren und gesünderen Leben. Denn wie auch westliche Forscher inzwischen bewiesen haben: Ärger und Aggressionen, aber auch das Gefühl, schutzlos allen Angriffen von außen ausgeliefert zu sein – das macht krank.
Der Begründer des Aikido, Meister Ueshiba Morihei. Er hat dem Ausübenden seiner Kampfkunst kategorisch jede Form aggressiven Verhaltens verboten: aus Achtung vor dem Leben.
“ FOTOS: FOTOSEARCH.COM, ALEXANDER T. IHLER
„Der Geist ist willig, allein, das Fleisch ist schwach“: Im westlichen Kulturkreis ist es eine selbstverständliche und unstrittige Annahme, dass Geist und Körper unabhängig voneinander existieren und sich mitunter im Weg stehen. Selbst wenn wir der Ansicht sind, dass dies gar nicht so sei, fällt es uns westlichen Menschen oft schwer, uns als Einheit zu verstehen. Japanern fällt dies leichter, doch sie arbeiten auch viel daran, den Körper mit dem Geist zu vereinen. Zum Beispiel soll durch Bewegung die innere Harmonie zwischen den beiden Aspekten hergestellt werden. Und dies soll zu Gesundheit, Langlebigkeit und allgemeinem Wohlbefinden führen. Ein Hauptziel der östlichen Kampfkünste und Kampfsportarten ist es, den Körper wieder zu seiner ursprünglichen Beweglichkeit zurückzuführen, einer Natürlichkeit, die wir als Kinder besaßen, die wir im Laufe der Jahre verloren haben. Spricht man von Gesundheit im Zusammenhang mit Kampfkunst, dann klingt das für westliche Ohren befremdlich, denn Kampfkunst wird mit kämpfen, verletzen oder gar töten in Verbindung gebracht. Japaner sehen dies anders.
17
auch in der Nahrung Schöne neue Welt: Technik und Gesundheit – ja bitte Japan – Kultur der Gegensätze. Auf der einen Seite das Land der Teezeremonien, der Meditation und des schintoistischen Geisterglaubens - auf der anderen Seite Hochtechnologie in allen Sparten. Das Roboterhündchen Aibo von Sony kann per Schwanzwedeln Gefühle ausdrücken und Honda-Roboter P3 gibt die Computerhand. Japanische Jugendliche sind ohne ihr Handy nahezu nicht lebensfähig, und sie spielen beinahe jede Lebenssituation per Computerspiel nach. Auch die Optimierung der Ernährung ist in Japan selbstverständlich. Functional Food sowie mit Vitaminen und Vitalstoffen angereicherte Nahrungsmittel gehören im Land der technikfreundlichen und gesundheitsbewussten Japaner zum Alltag. Bereits seit 1991 vergibt das japanische Gesundheitsministerium das Prädikat FOSHU (Food for specified health use, zu deutsch: Lebensmittel mit speziellem gesundheitlichem Nutzen). Kein Wunder also, dass es im Land der Entdeckung des
Coenzyms Q10 für Japaner an der Tagesordnung ist, sich dieses nur wenig in der Nahrung enthaltene Q10 per Nahrungsergänzung zuzuführen. In den 70er Jahren wurde in Japan eine Technologie entwickelt, mit der Coenzym Q10 fermentativ hergestellt werden kann. Lange Zeit konnte es nur aus Rinderherzen gewonnen werden, was schwierig und kostenintensiv war – ein Gramm kostete zu dieser Zeit 1000 Dollar. Jetzt steht Q10 in ausreichender Menge und zu erschwinglichen Preisen zur Verfügung. Ganz sicher ist die konsequente Ergänzung der Nahrung mit Q10 und anderen Vitalstoffen ein Faktor, der seinen Beitrag zur Langlebigkeit und der langen Gesundheit der Menschen in Japan leistet. Die Japaner nutzen auch hochdosierte Coenzym Q10-Präparate, um die in klinischen Studien nachgewiesenen therapeutischen und präventiven Wirkungen zu erzielen. Vor allem als wirkungsvoller Schutz vor Herzerkrankungen und Arteriosklerose hat sich Coenzym Q10 in hoher Dosierung bewährt. In den west-
lichen Nationen gehören Herzkrankheiten zu den Haupttodesursachen. Dabei ist Coenzym Q10 auch in Deutschland erhältlich - nur nicht so weit verbreitet wie im gesundheitsbewussten Japan. Ab dem 40. Lebensjahr kann der Körper Q10 nicht mehr so gut selbst herstellen und ist auf von außen zugeführtes Q10 angewiesen. Das macht eine ausreichende Zufuhr des Vitalstoffes ab diesem Alter sinnvoll. Auch für sportlich Aktive oder Menschen, die Medikamente einnehmen müssen, ist eine zusätzliche Versorgung mit Vitalstoffen zu empfehlen. Umweltbelastungen durch Ozon und Smog erhöhen den Vitalstoffbedarf zusätzlich. Unausgewogene Ernährung, Diäten, Appetitmangel und Verdauungsschwierigkeiten behindern ebenfalls eine gute Vitalstoffversorgung. Sollten Sie einer oder mehreren dieser Belastungen ausgesetzt sein, so ist eine zusätzliche Versorgung mit Vitalstoffen sehr empfehlenswert. Auch wenn Sie Alkohol oder Nikotin konsumieren, ist es empfehlenswert, Ihre Vitalstoffzufuhr zu verbessern.
FOTOS: TONY STONE , PHOTOS.COM
Die technikverliebten Japaner sind mit ihren Erfindungen noch lange nicht am Ende. Für die von der Regierung veranstalteten „RoboterWettbewerbe“ verbringen Kinder und Jugendliche oft ihre gesamten Ferien damit, einen Roboter zu bauen.
18
FOTOS: TONY STONE , FOTOSEARCH.COM, MARKUS JASER - WWW.JAPAN-FOTOGALERIE.DE
Tradition und Moderne. Für Japaner scheint das keinen Gegensatz darzustellen. Traditionelle Geishas und JapanGirlies, schintoistische Schreine und futuristische Schlafröhren, reglementierte Teezeremonien und sexuelle Freizügigkeit - in Japan geht das alles .
: Unerklärlich!
Japan in Kürze Offizieller Name: Nihon
Welcome to Japan. Please respect the rules. (Willkommen in Japan. Bitte beachten Sie die Regeln.) So steht es auf einem Begrüßungsschild für ausländische Gäste am Flughafen von Tokio zu lesen. Welche Regeln zu beachten sind, wird allerdings nicht erklärt. Sie haben jetzt viel über die gesunden und positiven Einflüsse der japanischen Kultur gelesen. Die japanische Gesellschaft befindet sich jedoch schon seit längerer Zeit in einem Wandel. Die Traditionen der Eltern gelten für die jüngeren Japaner (berechtigterweise, denn die Welt verändert sich) nicht mehr. Es ist stark zu bezweifeln, dass die Jugendlichen, die sich zunehmend mehr für Fast Food aus dem Westen interessieren und zum Beispiel den westlichen Trend übernommen haben, ihre Haut in der Sonne zu verbren-
nen, zu den ältesten Menschen der künftigen Generationen zählen werden. Für unser Verständnis sind Japaner auch skurril: Wussten Sie, dass sich japanische Rettungssanitäter vor dem Wiederbeleben eines Opfers die Schuhe vor der Wohnungstür ausziehen? Dass Japaner, wenn sie übermüdet sind, aus Höflichkeit lieber in der Öffentlichkeit schlafen, als ein Treffen mit Freunden abzusagen? Dass in einem japanischen Schwimmbad alle dreißig bis fünfzig Minuten zur gemeinschaftlichen Ruhepause per Lautsprecher aufgerufen wird – und dass ALLE das Becken verlassen und sich daran halten? Sie sind schon anders, die Japaner, und sie können über sich lachen. Eine japanische Fernsehsendung mit dem Namen „Die spinnen, die Japaner“, in der sich in Japan lebende Ausländer über die japanischen Eigenheiten lustig machen, erfreut sich – bei den Japanern – größter Beliebtheit.
Erdteil: Ostasien Landesfläche: 377.801 Km2 Hauptstadt: Tokyo Größte Städte: Tokyo, Yokohama, Osaka Höchster Berg: Fudschijama (3776 m) Währung: 1 Yenn =100 sen Bevölkerung: 126 510 000 Staatsführung: Kaiser (repräsentativ) Regierungsführung: Premierminister Politisches System: Parlamentarische Monarchie Zeitzone: MEZ+8,0 Stunden
19
Was ist der Buddhismus? Wo bestehen die Unterschiede zum Christentum?
Beide Religionen – Christentum und Buddhismus – wollen den Menschen einen Weg aufzeigen, wie er sich aus den Unzulänglichkeiten des Daseins befreien kann. Im Christentum führt dieser Weg über Gott, im Buddhismus führt dieser Weg über den Menschen selbst, der sein Heil ohne Beistand von außen allein realisieren muss. Im Christentum (auch im Judentum und im Islam) findet der Mensch in der Hinwendung zu Gott die Erleuchtung. Im Buddhismus muss sich der Mensch selbst von allen Bindungen loslösen, um Befreiung zu erfahren.
Wer war Buddha? Was bedeutet er für den Buddhisten?
Zunächst: Buddhisten beten nicht zu Buddha und „glauben“ nicht an Buddha in dem Sinne, wie Christen an Gott glauben. In der Philosophie des Buddhismus hat der „Glaube“ allenfalls die
Das einzig Beständige ist der stetige Wandel Zenbuddhismus, Schintoismus, Christentum – in Japan gibt es alle drei Glaubensrichtungen. Japaner sind häufig sogar Buddhisten und Schintoisten gleichzeitig. Der Buddhismus hat sich in Japan zum Zenbuddhismus, einer sehr alltagsverbundenen Richtung des Buddhismus entwickelt, in der dem Handeln und der Meditation eine sehr große Rolle zukommt.
D
er Buddhismus ist mit seinen vielen unterschiedlichen Schulen und Lehren eine der größten asiatischen Religionen – und auch bei uns in der westlichen Welt wird er immer beliebter. Doch ist der Buddhismus eine Religion? Die meisten Menschen würden sagen, dass Religion etwas mit dem Glauben an Gott zu
20
tun hat. So gesehen, ist der Buddhismus keine Religion, denn er kennt keinen Gott. Doch was ist er dann? Eine Weltanschauung oder eine Lebensform? Nach westlichen Maßstäben ist dies schwer zu beurteilen. Was immer er ist, der Buddhismus liegt im Trend. Bekannte Persönlichkeiten, Stars und Sportler beken-
nen sich öffentlich zu dem östlichen Glauben. Ist das nur eine Mode im allgemeinen EsoterikTrend? Die MEDICOM hat sich auf die Suche nach den Grundzügen des östlichen Glaubens gemacht.
Bedeutung von Vertrauen in den von Buddha gewiesenen Weg. Der Dalai Lama ist übrigens auch kein buddhistischer „Papst“, sondern der weltliche Herrscher Tibets und Oberhaupt einer bestimmten Richtung des Buddhismus. Die wichtigste Persönlichkeit des Buddhismus ist Buddha. Buddha, der Erleuchtete, ist die Bezeichnung für einen Menschen, der die Erleuchtung erreicht hat. Der historische Buddha war der Fürstensohn Siddharta Gautama, der etwa 500 vor Christus in Nordindien lebte. Nachdem Siddharta außerhalb seines behüteten Lebens mit den Tatsachen des menschlichen Daseins, wie Alter, Krankheit und Tod konfrontiert wurde, lässt er sein sicheres Leben hinter sich, lebt als Asket und versucht herauszufinden, warum die Menschen leiden müssen. Nachdem er sich fast zu Tode gehungert hat, ohne eine Antwort bekommen zu haben, beginnt er wieder zu essen. Er setzt sich unter einen Baum und beschließt, erst dann wieder aufzustehen, wenn er eine Antwort auf seine Frage hat. Schließlich erlangt er die Erleuchtung und zieht mit einer wachsenden Schar von Jüngern durch das Land.
Buddha verglich seine Lehre mit einem Floß, das man zurücklässt, wenn man das andere Ufer, das Ufer des Erwachens, erreicht hat. Er lehrt die „Vier edlen Wahrheiten“. 1. Alles ist Leiden. (Weil alles vergänglich ist, auch und gerade das Glück.) 2. Ursache dafür sind die drei Grundübel Gier, Hass und Verblendung. 3. Wenn man diese überwindet, endet das Leiden. 4. Der Weg der Überwindung des Leidens ist der heilige achtfache Pfad. Rechte Einsicht Rechter Entschluss Rechte Rede Rechtes Handeln Rechte Lebensführung Rechte Bemühung Rechte Achtsamkeit Rechte Sammlung oder Konzentration
Der historische Buddha bezeichnete Buddhisten glauben an die WieWas ist das sich selbst nur als Religionsstifter, dergeburt. Nach der buddhistiNirvana? er wollte nicht als Gott verehrt werschen Lehre reist ein Wesen von den. Buddha ist nur ein Lehrer, der Leben zu Leben. Viele gute Taten den Menschen Rat auf ihrem Weg in einem Leben führen zu einer zum Nirvana geben kann. Auf diesem Aufhäufung guten „Karmas“, was gute Weg ist der Mensch jedoch auf sich selbst Auswirkungen auf das nächste Leben hat. gestellt, er muss selbst erkennen und erAuf schlechte und grausame Taten folgt fahren. Durch immer mehr Wissen gelangt eine Wiedergeburt im Geisterreich, Tierer immer näher zum Nirvana. reich oder in den Höllenwelten. Nirgends jedoch macht ein Wesen endgültig halt – die Reise geht so lange weiter, bis das Nirvana erreicht ist. Nirvana bedeutet wörtlich „auslöschen“. Es steht für das Ende der Kette der Wiedergeburten. Hier hört alles Wollen und Streben und alle Bewegung auf, da es nichts mehr gibt, wonach man sich sehnen könnte. Die vier Verhaltensweisen, die ins Nirvana führen, sind Güte, Mitleid, mitfühlende Freude und Gleichmut. Im Buddhismus geht es um die Einsicht in die Zusammenhänge Worum des Lebens als eines Zustands geht es im dauernden Wandels und um die Bud-dhisErkenntnis, dass das Bestreben nach Sein und Haben, die Leidenschaften, die Sehnsüchte und Vorstellungen, das Streben nach persönlicher Erfüllung im Vergänglichen, nach Ansehen, Ruhm, Macht und dergleichen niemals völlig befriedigt werden können. Das Begehren schlägt in Hass gegen die verhinderte Wunscherfüllung um, so dass sich Die ethischen Prinzipien des Gier und Hass gegenseitig bedingen. Gier Buddhismus und Hass sind demnach Ausdruck einer Ich-Sucht und der fehlenden Einsicht in Streben nach eigener Einsicht und die Gesetzmäßigkeiten des Lebens. Sie Erkenntnis sind die Ursache für die unheilvollen ZuKein gierhaftes Verlangen und kein stände, die die Welt charakterisieren und Festhalten an materiellen Werten die Bedingungen schaffen, die der BudNeid, Eifersucht und Missgunst dhismus mit dem „Leiden“ meint. entsagen und sich am Wohl ande-
Die Zeit als Rad
rer erfreuen Nicht stehlen Nicht lügen Sich eines unmoralischen Lebenswandels enthalten Kein Lebewesen schädigen oder töten Allen Lebewesen (auch Pflanzen) Wohlwollen entgegenbringen Lieben, ohne Besitz zu ergreifen Ehrliches und rücksichtsvolles Handeln sich selbst und anderen gegenüber Rauschmitteln entsagen Gutes tun, ohne etwas dafür zu wollen
Der Buddhismus vergleicht die Zeit mit einem Rad, das sich dreht und stets an seinen Ausgangspunkt zurückkehrt. Wie die Natur im Wechsel der Jahreszeiten stirbt und wieder erblüht, so ist auch der Wechsel der Generationen geprägt von Geburt, Sterben und Wiedergeburt. Da nichts in der Welt von Bestand ist, muss ein Buddhist lernen, die Dinge hinzunehmen, die gegeben sind. Er kann mit seinen guten Taten jedoch Einfluss nehmen und schließlich ins Nirvana gelangen. Im Buddhismus geht es um die Erkenntnis, dass man nicht der eigene Körper ist, sondern dass man diesen hat, um ihn zu nutzen. Alles was man selbst erlebt, entsteht aus dem eigenen Bewusstsein heraus. Nach dem Tod verlässt dieses Bewusstsein den Körper, um sich später wieder mit einem neuen Körper zu verbinden.
FOTOS AUF DEN SEITEN 20 UND 21: DIGITALVISION
21
Länger gesund mit „pflanzlichen Hormonen“ Die Sojapflanze war in Asien schon vor mehr als 4.000 Jahren bekannt und galt als heilig. Soja wurde nicht nur als wertvolles Nahrungsmittel, sondern auch als Heilpflanze geschätzt. Auch hierzulande sind Sojaprodukte mittlerweile als nährstoffreiche und gesunde Lebensmittel anerkannt.
D
em eigentlichen Geheimnis der Sojabohne – obwohl im asiatischen Kulturkreis schon lange bekannt – kam die westliche Welt jedoch erst vor einigen Jahren auf die Spur: der wohltuenden Wirkung der Phyto-Östrogene. Bei den Phyto-Östrogenen handelt es sich um Pflanzenstoffe, die ihrer Struktur nach den vom Menschen selbst gebildeten Östrogenen ähneln, allen voran dem weiblichen Sexualhormon. Infolge dieser Ähnlichkeit mit den Östrogenen können Phyto-Östrogene an dieselben Rezeptoren binden wie ihre humanen Strukturverwandten und somit auch östrogenähnliche Wirkungen im
FOTO: PHOTODISC
Japanerinnen kennen keine Wechseljahresbeschwerden. Es gibt nicht einmal ein Wort dafür.
22
menschlichen Stoffwechsel erzeugen. Die wichtigsten Phyto-Östrogene sind die so genannten Isoflavone aus Soja. Aber auch in vielen Getreidesorten und Pflanzensamen kommen PhytoÖstrogene vor; diese werden als Lignane bezeichnet. Leinsamen enthält besonders viele Phyto-Östrogene; geringere Mengen Lignane finden sich außerdem in Kürbiskernen sowie in Weizenkleie, Roggen und Buchweizen. Das medizinische Phänomen, dass Japanerinnen keine Wechseljahresbeschwerden kennen, wird auf ihren hohen Soja-Konsum zurückgeführt. Mit den vielen verschiedenen Sojaprodukten, die in der japanischen Küche gebräuchlich sind, verzehren die Japanerinnen täglich wesentlich höhere
Frauen in den Wechseljahren haben infolge der nachlassenden Wirkung ihrer Östrogene zumeist auch ein erhöhtes Osteoporose-Risiko. Hier sind die PhytoÖstrogene ebenfalls hilfreich: Sie können nicht nur dem osteoporosebedingten Knochenabbau entgegenwirken, sondern sogar die Knochenmineraldichte erhöhen, z. B. im Oberschenkelhals. Phyto-Östrogene beeinflussen auch bestimmte Parameter des Knochenstoffwechsels positiv wie z. B. den Serumspiegel des Knochenproteins Osteocalcin. Damit nicht genug, sind Phyto-Östrogene auch antioxidativ wirksam und somit in der Lage, aggressive freie Radikale unschädlich zu machen. So können Isoflavone beispielsweise das LDL-Cholesterin im Blut vor Oxidation bewahren, also vor dem Angriff durch Sauerstoffradikale. Erst durch die Oxidation wird das LDL-Cholesterin tatsächlich zum potenziellen Risikofaktor für Arteriosklerose. Da die Phyto-Östrogene außerdem auch die Elastizität der Arterien verbessern,
wirken sie sich somit positiv hinsichtlich der Gesundheit von Herz und Kreislauf aus. Wie Untersuchungen zeigen, können Isoflavone als Antioxidanzien auch das sensible Erbmaterial der Zellen, die DNA, schützen und außerdem die Aktivität antioxidativer Enzymsysteme im Körper verstärken. Soja und Leinsamen stehen nach unseren Ernährungsgewohnheiten eher selten auf dem Speiseplan. Angesichts der zahlreichen positiven Effekte der PhytoÖstrogene empfiehlt es sich daher für Frauen in den Wechseljahren, sich zusätzlich über geeignete phytoöstrogenreiche Nahrungsergänzungen mit diesen wichtigen Substanzen zu versorgen.
Soja ist eine Hülsenfrucht und wächst in nur 100 Tagen an der einjährigen strauchigen Sojapflanze.
Was iert in den Wechseljahren?
N
ichts läuft ohne sie, die Hormone. Die winzigen Signalstoffe steuern die Funktion jeder Körperzelle und jedes Organs. Sie beeinflussen unser Wachstum, unseren Schlaf, unsere Verdauung, unsere Fortpflanzung und unsere Gefühle. Das weibliche Sexualhormon Östrogen hat zum Beispiel 400 vitale Wirkungen auf die Körperzellen. Doch in den Wechseljahren lässt die körpereigene Produktion von Östrogen nach. Das kann ab dem 40. Lebensjahr allmählich zu einem Mangelzustand führen. Jede Frau empfindet die körperlichen und seelischen Veränderungen auf unterschiedliche Weise. Es kommt oft zu Hitzewallungen, Schweißausbrüchen, Schlafstörungen und anderen Symptomen der hormonellen Veränderung. Viele fühlen sich auch oft reizbar oder erschöpft. Ungefähr 70 Prozent der deutschen Frauen leiden unter diesen typischen Wechseljahresbeschwerden. Früher waren Hormonersatz-Therapien mit Östrogen das Mittel der Wahl gegen diese Beschwerden. Heute nehmen immer mehr Frauen davon Abstand, denn eine wachsende Zahl von neuen Studien macht auf die Gefahren der HormonersatzTherapie aufmerksam (mehr dazu auf Seite 24). Phyto-Östrogene, die in Soja enthalten sind, stellen eine gute Alternative dar. Denn das Phyto-Östrogen kann sich wie das Human-Östrogen mit dem Zellkern verbinden. Ist die Östrogenkonzentration im Körper zu gering, dann können die Phyto-Östrogene an die nun freien Bindungsstellen des Zellkerns „andocken“. FOTO: CREATAS/PICTUREQUEST
Mengen an Phyto-Östrogenen als Frauen in den westlichen Industrieländern. Der Effekt: Die Isoflavone des Soja kompensieren dabei quasi die in den Wechseljahren nachlassende Produktion und Wirkung der körpereigenen Östrogene, und die typischen Beschwerden der Wechseljahre, wie z. B. Hitzewallungen oder Schweißausbrüche, treten weniger oder gar nicht auf. Studien mit Frauen in den Wechseljahren zeigten ebenfalls, dass Isoflavone aus Soja die Häufigkeit der Hitzewallungen reduzieren können.
23
Erhöhtes Brustkrebsrisiko durch Hormontherapie Die Gefahren einer Hormontherapie gegen Wechseljahresbeschwerden sprechen ebenfalls dafür, diese mit natürlichen Mitteln zu bekämpfen. Frauen, die in den Wechseljahren Hormone einnehmen, haben, einer neuen Studie zufolge, ein deutlich höheres Risiko, an Brustkrebs zu erkranken. Das gilt vor allem für die Kombinationsbehandlung mit den Hormonen Östrogen und Progestagen. Das besagt eine englische Studie, die vor kurzem in der renommierten Fachzeitschrift „The Lancet“ veröffentlicht wurde.
B
ei der bisher größten Untersuchung zum Thema Hormonersatztherapie wurden von 1996 bis 2001 mehr als eine Million Frauen zwischen 50 und 64 Jahren befragt. Dabei wurden die Art, die Länge und die Dosierung der Hormontherapie betrachtet. Über einen Zeitraum von zweieinhalb Jahren zeigte sich, dass Frauen, die eine Hormontherapie durchführten, im Vergleich zu Frauen, die niemals Hormonersatzpräparate verwendet hatten, ein um 66 % erhöhtes Brustkrebsrisiko sowie ein um 22 % erhöhtes Sterberisiko aufwiesen. Die Studie ergab außerdem, dass jede Art der Hormontherapie, wenn auch in unterschiedlichem Ausmaß, das Risiko erhöhte und dass das Risiko nach dem Absetzen der Präparate wieder sank. Bei der Beurteilung des gesamten Krankheitsrisikos schnitt die Östrogen/Progestagen-Kombinationstherapie bei weitem am schlechtesten ab (Krankheitsrisiko um 100 Prozent erhöht). Tibolon (Kombination aus Androgen, Östrogen, Gestagen) führte immer noch zu einem um 45 % erhöhten Gesamt-Krankheitsrisiko.
In Zukunft müssen Frauen in den Beipackzetteln wesentlich deutlicher auf gesundheitliche Risiken bei der Einnahme von Hormonpräparaten gegen Wechseljahresbeschwerden hingewiesen werden. Eine neue Studie macht erneut große Risiken deutlich. 1.156
Verordnung von Östrogenen
Im Vergleich dazu führte eine reine Östrogentherapie, wie sie bei Frauen ohne Gebärmutter eingesetzt wird, „nur“
1.037
in Millionen Tagesdosen
GARFIK: DPNY
884
FOTO: THINKSTOCK
QUELLE: ARZNEIVERORDNUNGSREPORT 2002
24
zu einem um 30 Prozent erhöhten Gesamt-Krankheitsrisiko. Grundsätzlich gilt: Je länger eine Hormontherapie durchgeführt wird, desto größer wird das Risiko, an Brustkrebs zu erkranken – unabhängig von der Dosierung und der Art des Östrogens oder Progestagens und auch unabhängig davon, ob die Hormonpräparate in Form von Tabletten, Pflastern oder Implantaten gegeben werden. Ab dem 1. November dieses Jahres müssen Hersteller von Hormonpräparaten gegen Wechseljahresbeschwerden in ihren Produktinformationen deutlich auf das Risiko von Brustkrebs, Herzinfarkten und Schlaganfällen hinweisen. Das berichtet das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) in Bonn. Dem Ergebnis dieser Studie folgend empfiehlt die Österreichische Krebshilfe Frauen, die sich einer Hormontherapie gegen Wechseljahresbeschwerden unterziehen, diese wenn möglich in Absprache mit dem Arzt zu beenden und auf Behandlungsalternativen zurückzugreifen. Die pflanzlichen Phyto-Östrogene aus Soja sind eine gute und wirksame Alternative zu den künstlichen Hormonen. Phyto-Östrogene unterstützen den Hormonhaushalt während der Wechseljahre und gleichen die fehlende Menge körpereigener Östrogene sanft aus.
HIER AUSSCHNEIDEN
VITALSTOFF lexikon
Gamma-Linolensäure Macht die Haut zart und weich
FOT O: D PNY
ie pflanzliche Gamma-Linolensäure gehört zu den Fettsäuren, die für den menschlichen Organismus am wichtigsten sind. Sie zählt zu der Gruppe der Omega-6-Fettsäuren. Diese sind unentbehrlich für die Steuerung vieler Körper- und Stoffwechselfunktionen.
D
Enthalten z. B. in
Gesunde Haut ist glatt und elastisch. Sie übersteht den „Zupftest“ ohne Spuren. Spröde, trockene und rissige Haut hingegen bleibt beim Zupftest stehen. Dies kann auf einen Mangel an GammaLinolensäure hinweisen.
Muttermilch, Borretsch-Öl
Herkunft - Funktion - Versorgung Gamma-Linolensäure hilft der Haut, ihre natürliche Barrierefunktion zu erfüllen. Besonders reich an Gamma-Linolensäure ist Borretsch-Öl, das somit die Gesundheit der Haut unterstützen kann. GammaLinolensäure ist ein Strukturbestandteil der Haut; sie ist beteiligt an der Regulation des Zellwachstums und spielt eine große Rolle bei der Zellerneuerung. Auch Muttermilch enthält viel GammaLinolensäure, denn sie ist maßgeblich an der Entwicklung des Neugeborenen beteiligt. Wissenschaftler glauben, dass bei Neurodermitikern und Psoriasis-Betroffenen die körpereigene Produktion von GammaLinolensäure gestört ist und sich deshalb die typischen Mangelerscheinungen zeigen: trockene, rissige Haut, Rötungen und Juckreiz. Gamma-Linolensäure ist in nennenswerter Menge (außer in Muttermilch) nur in wenigen Lebensmitteln enthalten. Es empfiehlt sich, bei Verdacht auf Mangelerscheinungen dem Körper mit Hilfe einer Nahrungsergänzung eine Extra-
FOTO: DPNY
ration Gamma-Linolensäure zuzuführen. Nahrungsergänzungen enthalten pflanzliche Öle mit unterschiedlichem Gehalt an Gamma-Linolensäure. Besonders reich an Gamma-Linolensäure ist das aus dem Samen der Borretschpflanze gewonnene Öl.
Verwendung von Gamma-Linolensäure Psoriasis/Neurodermitis: Gamma-Linolensäure kann Hautreaktionen abschwächen, den Juckreiz mildern und die Empfindlichkeit der Haut bei Kindern und Erwachsenen positiv beeinflussen. Ekzeme: Gamma-Linolensäure kann das Hautbild verbessern und den Juckreiz beseitigen.
Brauchen Sie Gamma-Linolensäure?
JA
Leiden Sie an einer Hauterkrankung wie Neurodermitis oder Psoriasis (Schuppenflechte)? Oder haben Sie andere Hautprobleme? (z. B. trockene Haut)
MEDICOM Sonderheft zum Ausschneiden und Sammeln
Wie viel Gamma-Linolensäure braucht der Körper? Empfehlung Unabhängige Ernährungswissenschaftler empfehlen eine tägliche Zufuhr von 440 mg Gamma-
MEDICOM 27. Ausgabe, Dezember 2003
FOTO: PHOTODISC
Schon bei einem angekreuzten „Ja-Feld“ könnte eine ergänzende Zufuhr von Gamma-Linolensäure hilfreich sein.
25
VITALSTOFF lexikon
FOTO: PHOTODISC
Omega-3-Fettsäuren Kraftstoff für Herz und Gehirn apaner und Eskimos sind wegen ihres reichlichen Fischverzehrs gesünder als die Mitteleuropäer. Daran haben insbesondere die Omega-3-Fettsäuren einen großen Anteil, denn Fisch ist sehr reich an Omega-3-Fettsäuren, die für viele Stoffwechselvorgänge bedeutend sind. Die besonders hochwertigen Fischöl-Fettsäuren EPA und DHA kann der menschliche Körper nur in geringem Umfang aus der pflanzlichen Alpha-Linolensäure selbst bilden. Eine Ergänzung der Ernährung mit Omega-3-Fettsäuren ist deshalb sehr sinnvoll.
J
Heringen, Thunfisch, Lachs, Makrelen, Heilbutt, Bachforellen, Hummer, Garnelen, Hecht und Miesmuscheln
Herkunft - Funktion - Versorgung Die wichtigsten Omega-3-Fettsäuren sind die Alpha-Linolensäure, die Eicosapentaensäure (EPA) und die Docosahexaensäure (DHA). Sie werden im Körper für den Aufbau und die Erhaltung der Zellwände gebraucht. In unseren Breiten führt man sich infolge geringen Fischverzehrs meist zu wenig Omega-3Fettsäuren zu. Eine unausgewogene Ernährung, Diäten oder Verdauungsstörungen können ebenfalls zu einer schlechten Versorgung mit Omega-3-
FOTO: DPNY
Wie viel Omega-3-Fettsäuren braucht der Körper? Empfehlung Unabhängige Ernährungswissenschaftler empfehlen eine tägliche Zufuhr von 700 mg bis 1.000 mg
Fettsäuren beitragen. In der Zeit des Wachstums in Kindheit und Jugend sowie in der Schwangerschaft ist der Bedarf an Omega-3-Fettsäuren aufgrund des raschen Zellwachstums erhöht. Über die Ernährung ist eine hohe Omega-3Fettsäurenzufuhr schwer zu erreichen. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung gibt an, dass Omega-3-Fettsäuren etwa 0,5 % der Energiezufuhr ausmachen sollten. Das entspricht bei einer Energiezufuhr von 2.000 Kilokalorien am Tag etwa einem Gramm Omega-3Fettsäuren. Britische Gremien empfehlen sogar eine tägliche Zufuhr von 1,2 g. Dies ließe sich nur durch eine massive Erhöhung des Fischkonsums erreichen. Mindestens dreimal wöchentlich müsste dann Fisch auf Ihrem Speiseplan stehen.
Vorbeugung gegen Arteriosklerose: Omega-3-Fettsäuren unterstützen die natürlichen Fließeigenschaften des Blutes und können eine cholesterinbewusste Ernährung unterstützen. Rheuma (Gelenkerkrankungen): Omega3-Fettsäuren können in hoher Dosis zur Gesundheit der Gelenke beitragen, indem sie überschießende Entzündungsreaktionen mildern. Die bei rheumatischen Krankheiten auftretenden Schmerzen, Entzündungen und Gelenkversteifungen können vermindert werden. Hoher Blutdruck: In sehr hoher Dosierung haben Omega-3-Fettsäuren eine blutdrucksenkende Wirkung. Depressionen: Eine Milderung von Depressionen durch Omega-3Fettsäuren wurde zwar schon beobachtet, gilt aber noch als umstritten.
Brauchen Sie Omega-3-Fettsäuren? Schon bei einem angekreuzten „Ja-Feld“ könnte eine höhere Aufnahme von Omega-3-Fettsäuren für Sie sinnvoll sein.
JA
Haben Sie ein erhöhtes Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen (z. B. familiäre Veranlagung, Rauchen)?
FOTO: PHOTODISC
Enthalten z. B. in
Verwendung von Omega-3-Fettsäuren
Essen Sie selten Fisch, insbesondere fettreichen Meeresfisch? Leiden Sie unter entzündlichen Erkrankungen des Bewegungsapparates (z. B. Rheuma, Polyarthritis)?
MEDICOM Sonderheft zum Ausschneiden und Sammeln
und das lange Leben in Japan
J
apaner essen etwa fünfmal so viel Fisch wie Deutsche und zählen weltweit zu den größten Fischfangnationen. Den Fisch kann man frisch, geräuchert, gegrillt oder getrocknet kaufen. Meistens wird er aber frisch verkauft. Fische enthalten die wertvollen Omega3-Fettsäuren, die zu den essenziellen, mehrfach ungesättigten Fettsäuren gehören, die der Mensch mit der Nahrung aufnehmen muss. Eine Vielzahl medizinischer und ernährungswissenschaftlicher Studien deutet darauf hin, dass Omega3-Fettsäuren eine positive Wirkung auf die Fließeigenschaft des Blutes haben. Das Blut wird flüssiger und kann somit auch in feinen Blutgefäßen besser fließen. Doch mit dem Genuss von viel Fisch geben die Japaner sich nicht zufrieden. Omega-3Fettsäuren in Form von Nahrungsergänzungsmitteln gehören in Japan zu den
neuesten und erfolgreichsten Mitteln auf dem Markt der Mikronährstoffe. Denn sie verhelfen nicht nur dazu, sehr lange sehr gesund zu bleiben – sie halten auch geistig fit. Da die Omega-3-Fettsäuren Bestandteile der Zellmembranen aller Körperzellen sind, spielen sie auch bei der Erhaltung der Gehirn- und Nervenzellen eine fundamental wichtige Rolle.
Gründen auch noch andere Ursachen dafür: In unseren Breiten bekommt man nicht überall frischen Fisch und er gehört zu den teuersten Nahrungsmitteln. Und: Nicht jeder mag Fisch. Wer aber nicht genügend Fisch zu sich nimmt, sollte zu Nahrungsergänzungen greifen, die Omega-3-Fettsäuren enthalten.
Es gibt Untersuchungen, die belegen, dass Omega-3-Fettsäuren in hoher Dosierung vor neurologischen Erkrankungen schützen, und, wenn diese bereits aufgetreten sind, sie sogar lindern können. So verhilft das Fischöl Japanern zu einem langen, gesunden Leben, und es sorgt gleichzeitig dafür, dass sie es auch bei bester geistiger Gesundheit genießen können. Leider ist der Verzehr von Fisch in den westlichen Industrienationen wenig verbreitet. Es gibt außer kulturellen
In Japan übersteigt die Zahl der Hundertjährigen erstmals die Marke 20.000. Laut dem japanischen Gesundheitsministerium dürften Ende September 20.561 Menschen im Alter von 100 Jahren oder älter in Japan leben. Die Zahl der Hundertjährigen stieg zum Vorjahr um 2627 und verdoppelte sich im Vergleich zum Jahr 1998. FOTO: TONY STONE
Japan ist die einzige Industrienation, in der die Menschen große Mengen an Omega3-Fettsäuren in Form von Fisch zu sich nehmen. Das ist der Grund dafür, dass die Herzinfarktrate dort sehr niedrig liegt. In jüngster Zeit steigt sie jedoch parallel mit dem Vordringen westlicher Ernährungsgewohnheiten an. Ein deutlicher Beweis für den Zusammenhang zwischen Herzgesundheit und der Einnahme von Omega3-Fettsäuren.
27
„Wir sollten den traditionellen Fischtag in Deutschland wieder aufleben lassen“, kommentierte der Internist und Privatdozent Dr. Peter Singer die Ergebnisse der von ihm durchgeführten Studie. Das wird aber nicht genügen, denn um 3 Gramm Omega-3-Fettsäuren am Tag zu sich zu nehmen, müssen Sie sehr viel Fisch essen. Schon das von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung empfohlene eine Gramm pro Tag (für Gesunde) zu erreichen ist nicht einfach. Bei den in Deutschland beliebtesten Fischarten Rotbarsch, Heilbutt und Forelle wären dazu 750 g pro Woche nötig – da muss man Fisch schon richtig mögen. Daher sollten Menschen mit Herzproblemen alternativ oder zusätzlich Fischöl-Kapseln mit Omega-3-Fettsäuren einnehmen, empfiehlt Singer.
Lange gesund dank Fischöl. Omega-3-Fettsäuren sind im Fisch enthalten. Sie schützen vor Herz- und Lungenerkrankungen. Doch mit hin und wieder mal etwas Fisch essen ist es nicht getan.
Neue Erkenntnisse zu Fischöl Neue Forschungsergebnisse belegen die positive Wirkung von Omega-3-Fettsäuren bei Herz-Kreislauferkrankungen und gegen Lungenversagen Neue Studie belegt: Schutz vor Reinfarkten und plötzlichem Herztod Seit langer Zeit sind in Fachkreisen die günstigen Wirkungen von Omega-3Fettsäuren (Fischöl) auf Herzerkrankungen bekannt. So sollen sie unter anderem die Wahrscheinlichkeit für Reinfarkte nach bereits erfolgten Infarkten um bis zu 30 % reduzieren können. Bislang lagen aber kaum Studien vor, die einen konkreten Nachweis dafür erbringen konnten. Wie die Fachzeitschrift „Die Medizinische Welt“ kürzlich berichtete, führt eine neue deutsche Studie, die die Wirksamkeit von Omega-3-Fettsäuren auf Herzrhythmusstörungen untersucht hat, jetzt den Beweis an. In der randomisierten und placebokontollierten Studie wurden 51 Patienten mit Herzrhythmusstörungen,
FOTO: DPNY
28
aber ohne koronare Herzkrankheit (durch verengte Herzkranzgefäße verursachte Mangeldurchblutung des Herzmuskels) und Herzinsuffizienz (Herzmuskelschwäche) in zwei Untergruppen unterteilt. Eine Gruppe erhielt über 6 Monate zu der ansonsten unveränderten Kost am Tag 3 Gramm Omega-3-Fettsäuren in Form von Fischölkapseln, die andere Gruppe erhielt ein Placebo. Bei der Gruppe, die das Fischöl einnahm, senkten sich der Triglyzerid- sowie der Fibrinogen-Spiegel, der Blutdruck sank und die Thrombozytenaggregation wurde reduziert. Damit wird Thrombosen und Blutgerinnseln vorgebeugt. Die Omega3-Fettsäuren senkten den Spiegel des „schlechten“ LDL-Cholesterins, während sie gleichzeitig den „guten“ HDL-Cholesterinwert hoben. Sechs Wochen nach Absetzen der Fischölkapseln wurden die alten Werte wieder erreicht. Bei der Gruppe, die ein Placebo nahm, gab es keinerlei Veränderungen.
Eine Studie an 82 Kliniken in Deutschland hat die lebensrettenden Eigenschaften von Fischöl bewiesen. In einer über mehrere Jahre andauernden Untersuchung des Dresdner Universitätsklinikums ergänzten die Wissenschaftler die Ernährung von Patienten auf den Intensivstationen mit Fischöl. In der Folge kam es weniger oft zu Lungenversagen, einer häufigen Todesursache bei Patienten auf Intensivstationen. Die Patienten litten unter weniger Infektionen und benötigten geringere Mengen an Antibiotika. Omega-3-Fettsäuren waren auch in diesem Fall die wichtigsten Bestandteile des Öls und damit Auslöser der lebensrettenden Wirkung. Die Dresdner Forscher präsentierten ihre Ergebnisse auf dem Kongress der Deutschen Gesellschaft für Anästhesiologie und Intensivtherapie in München.
FOTO: MARKUS JASER, WWW.JAPAN-FOTOGALERIE.DE
FOTO: PHOTOS.COM
Fischöl kann Leben retten
Besonders viele gesunde Fettsäuren sind in Fischen wie Lachs oder Thunfisch enthalten. Am besten eignet sich dabei frischer oder gefrorener Fisch.
Meditation in Bewegung
D
er Anblick der harmonischen Bewegungen übt auf den Betrachter eine gewisse Faszination aus. Es war im 13. Jahrhundert, als ein chinesischer Mönch einen Kampf zwischen einer Schlange und einem Kranich beobachtete. Der Mönch – mit Namen Cheng San Feng – bemerkte, dass der Vogel trotz seines spitzen Schnabels die Schlange nicht besiegen konnte, weil sie ihm immer wieder geschickt auswich. Das brachte den Mönch zu der Erkenntnis, dass die Schlange durch ihre geschmeidigen Ausweichbewegungen dem aggressiven Hacken des Vogels überlegen ist und dass das Weiche letztlich das Harte besiegt. Er entwickelte eine Bewegungs- und Selbst-
Tai
Chi
Chuan
verteidigungskunst, die auf dieser Erkenntnis beruht, und nannte sie Tai Chi Chuan. Tai Chi Chuan kommt eigentlich aus China, ist aber auch in Japan weit verbreitet. Zunächst in Klöstern zur Selbstverteidigung der Mönche geübt, wurde es später als Familiengeheimnis von Generation zu Generation weitergegeben. Bei dieser leicht zu erlernenden Bewegungskunst werden weiche, runde, langsam ausgeführte Bewegungen durch fließende Übergänge zu einer kontinuierlichen Bewegungsfolge, der Tai-Chi(Chuan) Form. Diese vereint Anteile von Heilgymnastik, Meditation, Bewegungskunst und Selbstverteidigung. Im Laufe der Zeit entstanden verschiedene Stile,
Bei der T-StepPosition ruht das ganze Gewicht auf einem Fuß, während der andere angezogen ist. Der angezogene Fuß wird sich gleich zu einem Schritt oder zu einem Tritt bewegen.
FOTOS AUF DER SEITE 29: TIBIA PRESS - FLOWMOTION-BUCH TAI CHI 2003
Vielleicht ist Ihnen bei einem Spaziergang im Park schon einmal eine Gruppe von Menschen aufgefallen, die mit langsamen, geschmeidigen Bewegungen in Zeitlupe zu tanzen schien. Bei diesem Tanz – der eigentlich eine Kampfkunst ist – handelte es sich sicher um Tai Chi Chuan.
29
Der Bogenschritt. Die Füße stehen so weit auseinander, als würde der Schüler auf einem Eisenbahngleis laufen, wobei ein Fuß auf jeder Schiene steht.
Die Tai-Chi-Chuan Form ist eine kontinuierliche Bewegungsabfolge.
30 30
Bei uns ist Tai Chi Chuan auch als „Schattenboxen“ bekannt, da meist allein gegen einen unsichtbaren Gegner „gekämpft“ wird. Der Begriff „kämpfen“ führt dabei etwas in die Irre. Zwar handelte es sich bei Tai Chi ursprünglich um eine Kampfkunst, doch sind die Bewegungen bei der heute praktizierten Form nicht schnell und hart, wie wir sie uns bei einem Kampf vorstellen, sondern weich und fließend. Auch handelt es sich beim modernen Tai Chi nicht um einen Kampf gegen einen äußeren Gegner, sondern man kämpft für die eigene Ausgeglichenheit. Die Mühelosigkeit der Bewegungen entsteht dadurch, dass Körper und Geist als Gesamtheit agieren. Tai Chi Chuan wird übersetzt als „Faust(kampf), der auf dem höchsten Pol bzw. Prinzip beruht“. Dabei steht der „höchste Pol“ für die höchste schöpferische Kraft, die Polarität von Yin und Yang. Wie auch in der Heilkunde oder in der Ernährungsphilosophie östlicher Kulturen geht es beim Tai Chi Chuan um das Fließen des Chi (japanisch Ki), den Fluss der Lebensenergie. Tai Chi stärkt Sehnen, Bänder und die Muskulatur, was dazu führt, dass Verspannungen sich lösen und die Lebensenergie ungehindert fließen kann. Durch die Entspannung wird die Atmung tiefer, sodass die Energie in den Unterbauch sinkt, sich dort sammelt und dann an die Orte im Körper gelangt, an denen sie am meisten benötigt wird. Weil in der Entspannung die Atmung
sehr tief ist, werden auch der Blutkreislauf und der Stoffwechsel optimal gefördert. Mit Tai Chi Chuan werden also nicht nur die Beweglichkeit verbessert und Haltungsfehler korrigiert, sondern die gesamte Gesundheit wird positiv beeinflusst. In diesem Prozess erlangt der Schüler eine starke innere Kraft, die sowohl dem Geist als auch dem Körper zugute kommt. In China, Taiwan, Japan und inzwischen auch weltweit wird Tai Chi vor allem zum Zwecke der Prävention von Herzkreislauf-Erkrankungen, Rückenerkrankungen, Gelenkproblemen und Verspannungen eingesetzt.
FOTO: PHOTODISC
die zwischen 24 und 108 Bewegungsfiguren lehren. Als Selbstverteidigungskunst ist Tai Chi Chuan weitestgehend in Vergessenheit geraten, nicht jedoch als Gesundheitslehre.
Yin & Yang, die universelle Energie
Das Yin & Yang-Symbol steht für die andauernde, sich gegenseitig durchdringende und darin ausbalancierte Beziehung zweier polarer Kräfte, also der Vereinigung der Gegensätze. Eine Störung dieses Gleichgewichtes verursacht einen Mangel auf der einen Seite und einen Überschuss auf der anderen Seite. Die Folgen dieses Ungleichgewichtes sind meist gesundheitliche Probleme. Mit Tai Chi Chuan versucht man, die Balance der gegensätzlichen Kräfte zu erreichen und zu erhalten. Die Anwendung des Tai Chi Chuan verkörpert in den Bewegungsabläufen bereits diese Gegensätzlichkeit: die Ruhe in der Bewegung. Es geht darum, Bewusstheit zu erlernen, und alles, was man tut, bewusst zu tun. Das bedeutet, Bewegungen und Aktionen langsam und konzentriert auszuführen und sie voll und ganz wahrzunehmen – sie bewusst zu gestalten. Krankheiten sind gemäß dieser Philosophie die Folge der Vernachlässigung dieser Bewusstheit im Handeln.
Der philosophische Hintergrund Philosophischer Hintergrund für die Wirksamkeit des Tai Chi Chuan ist die asiatische Weltsicht, dass alles einem ständigen Fluss der Veränderungen unterworfen ist, der sich aus der Polarität von Yin (weibliche Kräfte) und Yang (männliche Kräfte) ergibt. Nur im harmonischen Miteinander dieser Kräfte kann die Lebensenergie, das Chi (oder Ki) ungehindert fließen. Durch Bewegungen, die oft von Tierverhalten inspiriert sind, wird dieser Energiefluss stimuliert.
Wenn sich die Hand in keiner besonderen Postion befindet, sollte sie weder starr noch schlaff sein, damit die Energie frei fließen kann. Hier sehen Sie die Position „Die gute Faust“.
Bewegungen, die denen frei lebender Tiere nachempfunden sind. Diese Bewegungen basieren auf einer tiefen ursprünglichen Entspannung von Körper und Geist, denn je mehr man lernt, den Körper zu entspannen, desto entspannter wird auch der Geist – was wiederum positiv auf den Körper zurückwirkt.
Die Praxis Allen Tai-Chi-Chuan Formen gemeinsam ist der Wechsel (Yin & Yang-Prinzip) der Belastung der Beine und das oft gegensätzliche Kreisen der Arme. Die Beine stehen dabei fest auf dem Boden, während der Oberkörper flexibel bleibt. Schon die Namen dieser Übungen machen deutlich, dass der Ausführende ein Geschöpf ist, das zwischen Himmel und Erde lebt. Übungen mit Namen wie „Der weiße Kranich breitet die Flügel aus“ oder „Den Tiger zum Berg zurücktragen“ veranlassen die Schüler dieser Kunst, über die Bedeutung der Formen nachzudenken und sie beim Üben vor dem inneren Auge zu behalten. Die bewusste Umsetzung der inneren Bilder führt so zu den fließenden
B U C H - T I P P
Flowmotion-Tai Chi ist eine neue Form der Darstellung von Bewegung in einem Buch (mittels BildTechnik). Die Anleitungen sind so aufgebaut, dass sie leicht nachvollziehbar sind. Erschienen 2003 im TibiaPress Verlag. 12,80 Euro / ISBN 3-935254-06-7.
Medizinische Studien Tai Chi Chuan mindert Stresssymptome und reduziert das Auftreten von Ängsten, Depressionen, Schwäche und allgemeinen Stimmungsveränderungen. (Journal of Psychosomatic Research 1989 Vol33(2) 197-207)
Tai Chi Chuan minimiert die Auswirkungen von chronischen Krankheiten wie Allergien und Asthma. (American Juornal of Chinese Medicine 1981 Spring Vol.9(1) 15-22)
Tai Chi Chuan verbessert die Atemkapazität. (Hawaii Medical Journal (8) Vol. 5 1992
FOTOS AUF DEN SEITEN 30 UND 31: TIBIA PRESS - FLOWMOTION-BUCH TAI CHI 2003
Die körperlichen Bewegungen des Tai Chi Chuan haben einen geistigen Hintergrund, denn der Körper wird vom Geist gelenkt. Die koordinierten Körperübungen fördern demnach auch das geistige Wachstum. Es geht darum, dass der Körper und die Seele eins werden sollen.
31
Leicht, gesund und lecker Japanische Küche – mehr als Sushi All die Aspekte gesunden Bewusstseins, die zu einem erfüllten und langen Leben der Menschen in Japan beitragen, wären natürlich nicht vollständig
GE MA EI : TH TO FO NK BA
Eines der gesündesten Nahrungsmittel und allgegenwärtig in und auf Japans Tellern und Schüsseln: Fisch und Co
32
aufgezählt, wollten wir den langlebigen Japanern nicht in die Töpfe und auf die schön dekorierten Teller schauen. Von jahrtausende alten Traditionen geprägt, ist die japanische Esskultur eng mit der Kunst und der Philosophie verbunden. Essen ist für die Japaner eine sehr wichtige Angelegenheit. Und selbst wenn es ganz schnell gehen muss, schaffen sie es, dieses Fast-Food gesund zu gestalten. Höchste Ansprüche stellen die Japaner, was die Frische der Zutaten für ihre Mahlzeiten angeht. Nicht zuletzt auch deshalb und weil sie so leicht und gesund ist, erfreut sich die japanische Küche in Deutschland immer größerer Beliebtheit. Die Ästhetik der japanischen Gerichte und des Ambientes, die Verwendung exotischer Zutaten wie Seetang und die ungewohnten Esswerkzeuge sorgen zusätzlich für Faszination. Die meisten Elemente der japanischen Küche
stammen aus China. Dazu zählen zum Beispiel der Gebrauch des Woks, der sich ebenfalls hierzulande zunehmender Beliebtheit erfreut, und die Essstäbchen (jap. Hashi). Neben China zählt Indien zu einem der wichtigsten Ursprungsgebiete der japanischen Küche. Das bekannteste Beispiel ist wohl der Curryreis, der in Japan zu den beliebtesten Speisen zählt. Trotz der Anlehnung an die chinesische und die indische Küche hat die japanische Küche ein eigenes, unverwechselbares Wesen. In der japanischen Küche wird deutlich weniger Fleisch verwendet als in den meisten europäischen Küchen. Dies hat unter anderem auch mit dem Buddhismus zu tun, der eine vegetarische Ernährungsweise empfiehlt. Reis, Fisch, Meeresfrüchte, verschiedene Sorten von Gemüse, Nudeln und Sojaprodukte werden häufig gegessen. Eine besondere Zutat der japanischen Küche ist der Seetang, der in warmen Gewässern gezüchtet wird. Er begleitet als Gemüse aus dem Meer fast jede Speise. Das wichtigste Nahrungsmittel in Japan ist jedoch der Reis. Er wird zu allen Mahlzeiten, zum Frühstück, zum Mittagund zum Abendessen serviert. So wie der Reis ist auch die Sojasauce bei fast jeder Mahlzeit gegenwärtig. Während in den meisten europäischen Ländern ein gutes Mahl aus mehreren Gängen – also der Vorspeise, dem Hauptgericht und der Nachspeise – besteht, spielt eine solche Unterteilung in Japan keine große Rolle. Alle Speisen werden in der Regel gleichzeitig auf den Tisch gestellt, und man kann sich selbst aussuchen, in welcher Reihenfolge man sie essen möchte.
Gesundheit am laufenden Band. In manchen Restaurants fährt die Speise den Gästen „vor der Nase herum“. Sie brau
Warum is(s)t man in Japan gesünder? Aus ernährungswissenschaftlicher Sicht ernähren sich die Japaner weit ausgewogener als die Deutschen. Das ist auch einer der Gründe, warum sie bis ins hohe Alter gesünder bleiben als wir Europäer. Was aber macht die japanische Küche so gesund? Für Sie haben wir die wichtigsten Aspekte zusammengestellt.
liefern dem menschlichen Organismus hochwertiges und besonders leicht verdauliches Eiweiß und eine Vielzahl von Vitaminen und Mineralstoffen. Der Gesamtfettgehalt der meisten Fische ist relativ niedrig. Ausgenommen davon sind zum Beispiel Aal, Hering und Makrele. Fischfett ist ein besonders gesundes Fett. Insbesondere See-
Gesellig Ein gesundheitlich förderlicher Faktor sind die Gebräuche beim gemeinschaftlichen Speisen. Ob Sushi oder Suppe: Niemand bestellt sich ein Gericht für sich allein. Das Prinzip heißt „alles für alle“, und das ist nicht nur gesellig, sondern regt auch zur Mäßigung an, denn schließlich soll jeder probieren können.
Schon lange bevor Vitamine und Mineralstoffe von Wissenschaftlern erforscht wurden, war das asiatische Essen nährstoff und ballaststoffreich, mit wenig Zusatzstoffen und fettarm.
Fettarm Die Zubereitung der Speisen ist aus ernährungswissenschaftlicher Sicht vorbildlich: Gemüse und Fisch kommen meist roh oder mariniert (eingelegt) auf den Tisch. Das spart Fett, erhält das Aroma und die Nährstoffe. Gekocht oder gebraten wird im Wok – auch das ist fettsparend. Dazu kommen die fettarmen Zutaten. Der allgegenwärtige Reis liefert die wichtigen Kohlenhydrate und enthält nur sehr wenig Fett, dafür aber zahlreiche B-Vitamine. Ebenso zum Dessert, wenn es eines gibt, werden statt fettreicher Dickmacher wie Pudding oder Sahnedesserts Früchte serviert.
Fisch statt Fleisch Japaner essen etwa fünfmal so viel Fisch wie Deutsche; zudem beläuft sich der durchschnittliche Fleischverzehr eines Japaners auf nur etwa 25 Prozent dessen, was ein Deutscher verspeist. Fische
uchen einfach nur zuzugreifen.
Die Nahrung übt langfristig einen größeren Einfluss auf das Wohlbefinden und die Gesundheit aus als jeder andere Aspekt unseres Lebens.
FOTO: FOODPIX
fische enthalten die wichtigen Omega3-Fettsäuren. Diese Fettsäuren kann der menschliche Körper nicht selber herstellen. Er ist auf die Aufnahme über die Nahrung angewiesen. Wissenschaftler fanden in einer Studie heraus, dass für Menschen das Risiko, einen Herzinfarkt zu erleiden, durch die Omega-3Fettsäuren des Seefischs bis zu 44 % geringer ist. Daher sollten mindestens ein-
mal pro Woche, besser zweimal wöchentlich Thunfisch, Makrele oder Lachs auf dem Speiseplan stehen. Den positiven Einfluss von Omega-3-Fettsäuren auf Entzündungen im Körper konnten japanische Forscher nachweisen. Omega-3Fettsäuren haben insgesamt einen positiven Einfluss auf Herz und Kreislauf. Außerdem sind sie für die Ausbildung und Entwicklung des menschlichen Gehirns von großer Bedeutung. Damit sind Omega-3-Fettsäuren für alle Menschen zu empfehlen, vor allem jedoch für Kinder und Schwangere, da sie einen erhöhten Bedarf an diesen
FOTOS AUF DEN SEITEN 32 UND 33: PHOTODISC, DPNY, PHOTOS.COM
33
Frisch, knackig und gesund. Japaner verwenden nur ganz frische Lebensmittel.
sium, Phosphor sowie die B-Vitamine Thiamin (B1), Riboflavin (B2) und Niacin. Besonders beliebt ist Soja in Form von Tofu, einer Art Sojabohnenquark, den es buchstäblich in jeder erdenklichen Form und Geschmacksrichtung gibt. Für viele vielleicht nicht zu glauben: Tofuwürstchen oder Tofuburger schmecken tatsächlich so, als wären sie aus Fleisch hergestellt. Tofu kann jedoch auch als Pastete oder als Käse verwendet werden. Außerdem kann man Tofu frittieren, panieren, kochen, grillen oder pürieren. Im Sommer wird er gern mit Frühlingszwiebeln und geriebenem Ingwer kalt gegessen. Im Winter isst man Tofu dagegen warm, z. B. in Suppen sowie zu Fleisch- und Gemüsegerichten.
Seetang
Einblicke in Japans Küche
Soja
Fettsäuren haben.
Die tolle Bohne
Für Japaner gehören Sojaprodukte seit Jahrhunderten zu den Grundnahrungsmitteln, und sie profitieren in beeindruckender Weise von der gesunderhaltenden Wirkung der Bohnenprodukte. Sie haben, wie wir wissen, eine höhere Lebenserwartung und leiden seltener unter Krebs- und Herzkreislauferkrankungen als Menschen in der westlichen Welt. Untersuchungen haben zudem bestätigt: Japanerinnen kennen wegen ihres hohen Sojakonsums keine Wechseljahresbeschwerden. Dafür sorgen so genannte Phyto-Östrogene. Das sind Pflanzeninhaltsstoffe, die im menschlichen Körper eine ähnliche Wirkung wie körpereigene Östrogene – sogar eine sanftere als diese – haben und auch regulierend auf den Hormonhaushalt
34
FOTOS AUF DEN SEITEN 34 UND 35: PHOTODISC, DPNY, PHOTOS.COM
wirken. Isoflavone sind die wirkungsvollsten unter ihnen. Da Sojaprodukte im Rahmen unserer Ernährungsgewohnheiten jedoch selten verzehrt werden, empfiehlt es sich für Frauen in den Wechseljahren, die schützenden Phyto-Östrogene in Form von Nahrungsergänzungen zusätzlich zuzuführen. Mehr Informationen über Phyto-Östrogene finden Sie in diesem Heft auf der Seite 22 in der Rubrik „Neues aus der Forschung“. Wer nun denkt, dass so etwas Gesundes wie Soja auf keinen Fall schmecken kann, der irrt. Der kulinarische Variantenreichtum von Soja ist beeindruckend. Am besten bekannt ist wohl die Sojasoße, die jedoch kaum Isoflavone enthält. Kosten Sie doch auch einmal Sojanüsse, Sojasprossen oder Sojamilch, die übrigens eine hervorragende Alternative zur Kuhmilch ist. Sojamilch enthält keine Lactose und ist deshalb besonders für Menschen geeignet, die keine Lactose vertragen. Und: Produkte aus Soja sind kalorienarm, fettarm und cholesterinarm und eine gute Quelle für Mineralstoffe wie Calcium, Eisen, Magne-
Das gesunde Gemüse aus dem Meer Mehr als 300.000 Tonnen Meeresalgen ernten die Japaner jährlich. Das grüne Gemüse wird zu Sushi verarbeitet und zu vielen anderen Gerichten als Beilage serviert. Algen werden in Japan wie Gemüse verwendet. Sie sind reich an Vitalstoffen wie Jod, Kalium, Calcium, Eisen und den Vitaminen C und B12. Als Gemüse verzehrt sind Meeresalgen gut für das Herz und wirken entgiftend. Oft sind sie jedoch mit Schadstoffen belastet und von daher nur bedingt zu empfehlen. Von Nahrungsergänzungen, die Meeresalgen enthalten, ist jedoch in jedem Fall abzuraten. Sie enthalten nicht die vollständige Wirkungskraft der gesunden Inhaltsstoffe und sind zum Teil unverhältnismäßig teuer.
Ginseng Die „Menschenwurzel“
Die Ginseng-Wurzel sieht ein bisschen aus wie ein kleines Männchen. Das Wort „Ginseng“ bedeutet auch „Men-
schenwurzel“. Die außergewöhnliche Form hat die Phantasie der Menschen schon immer beschäftigt. Doch noch erstaunlicher als ihre Form ist ihre Wirkung. Ginseng zählt in der traditionellen chinesischen Medizin, die auch in Japan zur Anwendung kommt, zu den ältesten Heilmitteln. Doch er wird zudem oft und gerne in der japanischen Küche verwendet. Zum Beispiel als Tee, als Marmelade oder als Gewürz. Seit mehr als 5.000 Jahren wird seine gesundheitsfördernde Wirkung bereits genutzt. Im Arzneibuch der chinesischen Kaiser steht Ginseng an erster Stelle. Um die Lebenskraft zu erhalten, sollte die Wurzel nach Ansicht chinesischer Heilkundiger ab dem dreißigsten Lebensjahr täglich eingenommen werden. Das Besondere an Ginseng ist, dass die Wurzel immer dort wirkt, wo sich eine körperliche Schwachstelle befindet. Ginseng ist ein so genanntes „Adaptogen“, ein Mittel, das es dem Körper erlaubt, sich besser den jeweiligen Erfordernissen anzuen, indem es die Körperfunktionen in Einklang bringt. Das kann sich z. B. in einer besseren Anung an StressSituationen äußern. Die in der Wurzel enthaltenen Ginsenoside stärken den Herz- und den Blutkreislauf und aktivieren die Widerstands- und Regenerationskraft. Sie fördern die körperliche und seelische Leistungsfähigkeit und können so Erschöpfungszuständen vorbeugen. Diese Wirkungen sind medizinisch bewiesen. Der Wurzel werden noch andere pos i t i v e Eigenschaften zugeschrieben. So soll sie zum Beispiel potenzfördernd wirken, was aber nicht klinisch belegt wurde. Um die heilsamen Wirkstoffe zu bilden, muss die Pflanze mindestens drei, besser noch sechs Jahre wachsen. Heimisch ist Ginseng in Korea, in China, in Sibirien und in Japan. Der koreanische Ginseng gilt allerdings als der beste. Der Anbau ist nicht leicht, denn Ginseng bedarf besonderer Pflege. Das erklärt die relativ hohen Preise, die für die Wurzel v e r l a n g t werden. Von den gesundheitsfördernden
Shiitake-Pilz
Wirkungen des Ginsengs können Sie auch in Form von Phytopharmaka (pflanzlichen Arzneimitteln) profitieren.
Viel Gesundes unterm Hut In der asiatischen Küche wird der auch a l s Heilmittel verwendete Edel-Pilz schon lange als Delikatesse geschätzt. Der schmackhafte Pilz ist seit mehr als 2.000 Jahren bekannt. Er besitzt nicht nur ein unvergleichliches Aroma, sondern versorgt den Körper auch mit einer Vielzahl von Stoffen: hochwertiges Eiweiß, B-Vitamine, Ergosterol (eine Vorstufe des Vitamin D) und jede Menge Mineralstoffe wie Kalium, Calcium, Zink und Eisen. Besonders wertvoll machen ihn aber eine Reihe v o n sekundären Pflanzenstoffen. Sie sollen unter anderem den Blutzucker- und den Cholesterinspiegel positiv beeinflussen, das Immunsystem stärken, hohem Blutdruck entgegenwirken, vor Krebs schützen und der Zellalterung entgegenwirken können. Normalerweise werden in Deutschland die in Japan gezüchteten Pilze verkauft. Es gibt jedoch auch in Deutschland gezüchtete Pilze. Der Shiitake-Pilz braucht sechs Monate, bis er erntereif ist.
Grüner Tee
Der Gesundheitstrank Grüner Tee wird in Japan zu allen Mahlzeiten getrunken und immer und überall angeboten. Grüner Tee ist nicht nur gesund, er steigert auch das allgemeine Wohlbefinden. Und: Er ist ein praktisch kalorienfreies Getränk, das Kalium, Fluor, Mangan sowie die Vitamine B1 und B2 liefert. Je nach Herkunft und Qualität enthalten die Blattknospen und Blätter 1 bis 5 % Koffe-
in, kleine Mengen an Theobromin und Theophyllin, ätherische Öle, 7 % bis 12 % Gerbstoffe sowie andere sekundäre Pflanzenstoffe (Polyphenole). Diese wirken antibakteriell und beugen so Karies vor. Unterstützt wird dieser Effekt von dem im Tee enthaltenen Fluor, das die Zähne zusätzlich vor Karies schützt. Das Koffein des Tees, das früher Teein genannt wurde, ist identisch mit dem des Kaffees, liegt jedoch im Teeblatt in einer anderen Bindungsform vor. Nach dem Aufgießen des Tees mit aufgekochtem und wieder auf ca. 70-80° C abgekühltem Wasser, gehen schon in den ersten beiden Minuten etwa 75 % des Koffeins in den Aufguss über. In diesem Fall herrscht die anregende Wirkung auf das zentrale Nervensystem vor. Bei längeren Brühzeiten (bis zu fünf Minuten) gehen auch die Gerbsäuren in Lösung, die dem Tee eine bittere Note geben. Die Gerbsäuren bilden zusammen mit dem Koffein eine schwer lösliche Verbindung, die vom Körper kaum noch aufgenommen wird – so ist die Wirkung des Koffeins bei Tee, der länger gezogen hat, entsprechend schwächer. Dafür bringen die Gerbstoffe großen gesundheitlichen Nutzen: Sie beruhigen Magen und Darm, haben eine leicht stopfende
Neueste Forschungsergebnisse Wissenschaftler haben jetzt in einer neuen Studie herausgefunden, wie grüner Tee die Entstehung von Krebs blockieren kann. Dass das der Fall ist, war schon länger bekannt, nicht jedoch der Wirkungsmechanismus. Das sind die Ergebnisse: Wenn krebserregende Stoffe in den Körper gelangen, wird ein bestimmtes Eiweißmolekül aktiviert, das zu der krankmachenden Wirkung dieser Stoffe im Körper führt. Zwei Substanzen aus dem Tee-Extrakt fangen diesen Botenstoff jedoch ab und vermindern so die Entstehung von Krebs. Diese sekundären Pflanzenstoffe haben zusätzlich eine hohe antioxidative Wirkung und können Freie Radikale unschädlich machen. Bisher nahm man daher an, dass die krebsvorbeugende Wirkung des grünen Tees ausschließlich der antioxidativen Wirkung der Flavonoide zuzuschreiben sei. Dass sie jedoch noch über weitere Wirkungsmechanismen gegen Krebs verfügen, beweist diese Studie. Mehr dazu auf Seite 15.
35
Drei wichtige Faktoren, die die Qualität einer japanischen Mahlzeit bestimmen Die Frische der Produkte Japaner legen sehr viel Wert auf frische Produkte, besonders bei Fisch.
Die optische Präsentation Man legt Wert auf die Anordnung der einzelnen Bestandteile des Gerichts auf dem Teller, die Komposition der unterschiedlichen Farben des Gemüses und das verwendete Geschirr. Oft versucht man, das Geschirr end zur aktuellen Jahreszeit und zu der Farbe der in der Region blühenden Blumen zu wählen.
Gesunde und natürliche Zutaten sind in der asiatischen Kochkultur sehr wichtig.
Die Vielfältigkeit der Gerichte Je mehr verschiedene Bestandteile ein Gericht enthält, desto qualitativ hochwertiger und kostspieliger ist es. Im Gegensatz zu unseren Essgewohnheiten sind die japanischen Essgewohnheiten dadurch geprägt, dass – anstelle eines Hauptgerichts mit wenigen Beilagen – viele Formen von Fisch, Gemüse, Reis, Nudel etc. in kleinen Portionen gegessen werden.
Schon gewusst? Der Fleischverbrauch in Japan ist deutlich geringer als in Deutschland, doch die Qualität des Fleisches ist sehr hoch. Das teuerste Fleisch ist das des KobeRindes. Damit das Fleisch ganz zart wird, wachsen die Tiere unter besonderen Umständen heran. Die Kühe werden täglich mit Bier gefüttert, bekommen Entspannungsmassagen und erfrischende Wasserduschen im Sommer. Das Bier verringert den Stress der Tiere, und die Massagen wirken entspannend auf die Muskulatur.
FOTO: PHOTODISC
Qualität gehört zur japanischen Mahlzeit
In der asiatischen Tradition ist Ki (oder Qi) die kosmische Energie, die alles durchfließt, die Sonne und ihre Planeten, die Luft, alle Gegenstände, Tiere, Pflanzen und jeden Menschen. Auch jede Art von Nahrung enthält ihr eigenes Ki.
B U C H - T I P P
Steven Saunders & Simon Brown „feng shui food“ Christian Verlag, 180 Seiten, ca. 20,50 Euro Ryuichi Yoshii „Sushi Rezeptbuch“ Collection Rolf Heyne , 112 Seiten,
FOTO: TONY STONE
ca. 22 Euro
36
Vitalstoffe auf japanisch Die Japaner glauben, dass beim Essen alle Sinne angesprochen werden sollten. Daher werden die Speisen immer mit besonderer Sorgfalt zubereitet und schön serviert. Sushi, die kleinen Meisterwerke aus der traditionellen japanischen Küche, gelten in Japan als eine Kunstform. Doch Sushi können auch so einfach sein, dass sie jeder selbst zu Hause zubereiten kann. Wie dieses köstliche Rezept zum Beispiel.
Maki-Sushi
(Für 4 Personen)
Zubereitung
FOTO: DPNY
Einfach die Füllung auf das Blatt legen und dann einrollen.
Zutaten
§
Lecker, leicht und leicht gemacht: Sushi aus eigener Küche
§
Nährwertangaben
§
200 g
§
japanischer Sushi-Reis (oder Milchreis) 100 g frischer Thunfisch 100 g frischer Seebarsch 8 bis 10 Blätter Nori (getrockneter Seetang) 8 mittelgroße Shrimps 3 Radieschen 1 Bambus-Rollmatte (oder Frischhaltefolie) 1 Schale mit einem Reisessig-Wasser-Gemisch (anstelle von Reisessig kann auch Apfelessig verwendet werden) Wasabipulver (oder geriebener Meerrettich) Frühlingszwiebeln Frischer Ingwer Zum Dippen: Sojasoße
FOTO: DPNY
§
Den Fisch in ca. 4 cm dicke lange Streifen schneiden. Die Shrimps schälen und dabei jeweils den schwarzen Darmfaden entfernen. Die Frühlingszwiebeln putzen, waschen und in Streifen schneiden. Den Ingwer und die Radieschen in Scheiben schneiden. Den Sushi-Reis mit etwas Reis-Essig in Wasser so lange kochen, bis er klebrig und weich wird. Danach abkühlen lassen. Die Hände gründlich mit dem Essig-Wasser-Gemisch befeuchten, damit der Reis nicht an den Händen kleben bleibt. Zum Aufrollen können Sie statt einer Bambus-Rollmatte auch Frischhaltefolie benutzen. Verwenden Sie für die Sushi-Rollen drei verschiedene Füllungen – jeweils Thunfisch, Seebarsch oder Shrimps. Ein Nori-Blatt auf der Rollmatte bzw. Frischhaltefolie auslegen und den Reis daraufgeben. In die Mitte legen Sie den Fisch, die Frühlingszwiebeln, die Radieschen und etwas Ingwer. Abschließend etwas Wasabipulver bzw. geriebenen Meerrettich darauf verteilen. Vorsichtig aufrollen. Dann die Rolle in ca. 5 cm lange Stücke schneiden. Zusammen mit 4 Schälchen, die mit Sojasoße gefüllt sind, anrichten.
(Pro Portion) Energie Eiweiß Fett Kohlenhydrate Ballaststoffe
295 kcal 21 g 3 g 42 g 2 g
Vitamin B1 Vitamin B2 Vitamin B6 Vitamin C Vitamin D Magnesium Calcium Cholesterin
0,1 0,1 0,4 9 2,8 58 64 82
mg mg mg mg µg mg mg mg
37
Leserbriefe Liebe MEDICOM-Leser, möchten Sie kritisch oder zustimmend zu einzelnen Themen im Heft Stellung nehmen? Oder interessante Tipps zum Thema „Gesund werden – gesund bleiben“ an andere Leser weitergeben? Dann schreiben Sie uns! Unsere Anschrift lautet: MEDICOM-Redaktion, Sedemünder 2, Altenhagen I, 31832 Springe.
seite stellt der ADC alle sieben kirchlichen und weltlichen deutschen Chorverbände vor. So kann sich jeder nach seinem Geschmack vororientieren und dann natürlich über die eingerichteten Links ganz nach seinen Wünschen weitergehen. Er/sie wird viele Möglichkeiten entdecken – und das in der Regel umsonst oder zu sehr günstigen Preisen. Wem es nicht behagt, im Internet auf die Suche zu gehen, der kann sich auch gern auf traditionellem Wege mit seinen Fragen an die ADC wenden. Die Adresse lautet: ADC, Adersheimer Str. 60, 38304 Wolfenbüttel. Tel.: 0 53 31/4 60 18 Fax: 0 53 31/ 4 37 23 Mit besten Grüßen R. Pasdzierny, Geschäftsführer des ADC Sehr geehrter Herr Pasdzierny,
Singen Medicom 25 Schön, dass Sie dem so wichtigen Thema Singen in der MEDICOM-Kundenzeitschrift Raum gegeben haben. Wenn es nicht schnell und nachhaltig zu einer Rückbesinnung darauf kommt, wie wichtig Musik und speziell das Singen für das menschliche Leben ist, dann kann das negative Folgen für die Gesundheit des Einzelnen und für die Gesellschaft im Ganzen haben. Vor allem unseren Kindern sollte es baldmöglichst wieder deutlich gemacht werden, dass Musik nicht nur darin besteht, einen Kopfhörer aufzusetzen und sich berieseln zu lassen. Nur das eigene aktive Singen und Musizieren eröffnet den wahren Horizont der Möglichkeiten von Musik. Zum Glück zeichnet sich in letzter Zeit ein positiver Wandel ab. Unter anderem hat sich der Bundespräsident höchstpersönlich für die Musik eingesetzt. Am 09.09.2003 lud er zu einem Projekttag „Musik für Kinder“ in seine Berliner Residenz. In Schloss und Park Bellevue zeigten an diesem Tag Hunderte von Kindern, was sie musikalisch konnten und wie viel Spaß sie dabei hatten. Bun-
38
MEDICOM 27. Ausgabe, Dezember 2003
despräsident Rau wollte damit ein Zeichen setzen für die dringende Notwendigkeit der Rückbesinnung darauf, dass aktives Musizieren und Singen wieder einen selbstverständlichen Platz im schulischen und außerschulischen Alltag von Kindern (und Jugendlichen und Erwachsenen) haben müssen. Auch im Bereich des organisierten Singens in Chören gibt es Strukturveränderungen: Männerchöre alter Prägung z. B. gibt es immer weniger; aber die Zahl der Kinder- und Jugendchöre steigt. Und es ist eine ganz neue Form von Chören entstanden: die Projekt- oder Telefonchöre. Hier trifft man sich nicht mehr regelmäßig, immer am gleichen Ort. Vielmehr plant man ein bestimmtes Projekt, telefoniert sich zu einer ausgiebigen Probenphase zusammen, gibt einige Konzerte und geht dann wieder auseinander – bis zum nächsten Mal. Mein zusätzlicher Tipp zu den von Ihnen gegebenen Informationsquellen zum Thema Singen in Chören: die Homepage der Arbeitsgemeinschaft deutscher Chorverbände, ADC, im Internet unter der Adresse www.adc-chorverbände. Im ADC sind alle Chorverbände Deutschlands zusammengeschlossen. Auf der Internet-
herzlichen Dank für Ihre umfangreichen und kompetenten Informationen, die unsere Leser sicher sehr erfreuen werden. Mit den von Ihnen gegebenen Informationen an der Hand, finden interessierte Leser bestimmt leicht einen enden Chor. An der positiven und umfangreichen Resonanz unserer Leser auf den MEDICOM-Artikel über das Singen haben auch wir festgestellt, wie sehr das Thema „die Gemüter bewegt”. Ein Zeichen für das große Bedürfnis nach dem Singen ist auch die gesteigerte Medienpräsenz von Gesangswettbewerben und Talentshows im Fernsehen. Es beginnt sich offensichtlich ein „Pro-SingenTrend“ zu etablieren, der sehr zu begrüßen ist. Wir wünschen Ihnen und Ihrer Arbeitsgemeinschaft weiterhin viel Spaß und Erfolg!
Impressum Herausgeber:
Verlag, Redaktion, Gestaltung: Druck:
Medicom Pharma AG Sedemünder 2, Altenhagen I 31832 Springe Tel. (0 50 41) 78-0 Fax (0 50 41) 78-11 69
DPNY communications Hofmann-Druck
„MEDICOM“ ist eine Kundenzeitschrift der Medicom Pharma AG; sie erscheint fünfmal jährlich. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung des Herausgebers.
Wir behalten uns vor, Leserbriefe zu kürzen. Für unverlangt eingesandte Manuskripte, Fotos und Illustrationen kann keine Haftung übernommen werden.
1. Preis: Gesundheitsferien in der Klinik im Hofgarten
Lösung:
Kreuzworträtsel Liebe Rätselfreunde, diesmal geht es bei dem Lösungswort um etwas, das sehr gut für die Augen ist. Tragen Sie die Buchstaben in den nummerierten Feldern in der richtigen Reihenfolge ein. 1. Preis: eine Woche Gesundheitsferien in der Klinik im Hofgarten, Bad Waldsee, für zwei Personen im Wert von 1.300,– Euro. 2. bis 4. Preis: je ein Rezeptbuch „Sushi“ aus der Collection Rolf Heyne
Lösungen aus dem Mai-Heft
Und so können Sie gewinnen Haben Sie das richtige Lösungswort? Dann schreiben Sie es auf eine Postkarte, und schicken Sie diese an: MEDICOM-Redaktion, Stichwort: „Preisrätsel“, Sedemünder 2, Altenhagen I, 31832 Springe. Einsendeschluss ist der 31.12.2003 (Datum des Poststempels). Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Mitarbeiter der Medicom Pharma AG und deren Angehörige dürfen nicht teilnehmen. S C H O N
G E W U S S T ?
Affentheater Straßenraub, Taschendiebstahl, Hausfriedensbruch, Raubüberfälle, Plünderungen in affenartiger Geschwindigkeit: In Japan hat man es mit einer bislang unbekannten Form krimineller Energie zu tun, einer tierischen. Organisierte Affenbanden machen Naturschutzgebiete unsicher. Die Makaken stürmen Autos, reißen Touristen die Taschen aus den Händen, überfallen Spaziergänger und plündern sogar in Supermärkten. „Daran sind die Touristen schuld“, sagt ein Affenforscher. „Die Affen haben sich daran gewöhnt, dass ihnen die Touristen leckeres Futter geben, und wenn es nun nicht reicht, dann holen sie es sich einfach.“
Inzwischen dürfen die Touristen „dem Affen keinen Zucker mehr geben“. Der Magistrat hat das Füttern der Primaten verboten.
FOTO: DPNY, PHOTODISC
MEDICOM – immer an Ihrer Seite „Ihre Gesundheit ist unsere Aufgabe“ – das ist unser Motto. Die MEDICOM steht Ihnen mit sinnvollen Produkten in Ihrem Alltag zur Seite. Wir wollen, dass Sie Ihren Tag mit der Gewissheit erleben, Ihre Gesundheit aktiv zu unterstützen. Mit den Produkten von MEDICOM können Sie Ihre Gesunderhaltung auf anspruchsvollem Niveau fördern. Ob Sie bei Ihrer Vitalstoffversorgung auf Nummer Sicher gehen wollen oder ob Sie einen bestimmten Bedarf Ihres Körpers gezielt ausgleichen wollen – wir versuchen Ihnen immer das zu bieten, was Ihnen und Ihrer Gesundheit dienlich ist. Haben Sie Fragen zum Thema „Gesundheit und Vitalstoffe“? Die Mitarbeiter unserer wissenschaftlichen Abteilung werden Ihnen gerne all Ihre Fragen in einem persönlichen Gespräch am Telefon beantworten. Auch unser Kundendienst gibt Ihnen gern Auskunft zu unseren Produkten. Sie erreichen beide unter einer gebührenfreien Telefonnummer. Ihre Zufriedenheit und Ihre Gesundheit stehen bei der Medicom Pharma AG an erster Stelle. Unser Bestreben ist es, Ihrem Vertrauen, das Sie uns als Kunde entgegenbringen, in jeder Form gerecht zu werden – sowohl
mit unseren hochwertigen Produkten als auch mit sinnvollen Serviceleistungen. Bei der Herstellung unserer Produkte verwenden wir nur die hochwertigsten Rohstoffe – damit die Wirkstoffe vom Körper optimal genutzt werden können. Die Herstellung erfolgt nach dem strengen GMP-Standard. Wenn Sie ein Produkt der MEDICOM erwerben, dann entscheiden Sie sich für Qualität. Bei der MEDICOM endet die Beziehung zum Kunden nicht mit der bezahlten Rechnung. Mit unseren Serviceleistungen – die weit über das Übliche hinausgehen – wollen wir Ihr Partner in Sachen Gesundheit sein: Sie bekommen als Kunde 5-mal im Jahr das Kundenmagazin MEDICOM. Sie erhalten auf all unsere Produkte eine Geld-zurück-Garantie. Sie erhalten Ihre Produkte innerhalb von 48 Stunden frei Haus gegen Rechnung. Sie können unsere Produkte per Post, per Fax, am Telefon und im Internet anfordern. Und als Sammelbesteller erhalten Sie einen interessanten Preisnachlass. Wir wollen alle Ihre Bedürfnisse in Sachen Gesundheit befriedigen und Ihnen in Ihrem täglichen Leben zur Seite stehen. Wir sind für Sie da. Wir sind Ihr Partner in Sachen Gesundheit.
Im Internet: www.medicom.de • Kostenlose Ernährungsberatung: 0800 73 77 730
GESUNDHEIT
TIPPS
FITNESS
ERNÄHRUNG
FOTOMONTAGE: DPNY
AKTUELLE GESUNDHEITS-INFORMATIONEN FÜR KUNDEN DER MEDICOM PHARMA AG . 27. Ausgabe, Dezember 2003
Editorial
Viel Spaß beim Lesen wünscht Ihnen Ihre
I
m Hintergrund schneebedeckte Wipfel, sonnenbeschienene Gärten und ein Tempel im Vordergrund. So kennen wir den japanischen Winter von den bunten Bildern, die zumeist die Wände japanischer Restaurants schmücken. Gerade jetzt um die kalte Jahreszeit, suchen Sie ein Restaurant vielleicht sogar noch öfter auf als im Sommer. Und beim Japaner sitzen Sie richtig. Warum? Weil die Japaner sehr viel länger leben als wir westlichen Menschen und auch im hohen Alter noch bei bester Gesundheit sind. In keinem anderen Land auf der Erde leben so viele so gesunde ältere Menschen. Und das liegt zu einem sehr großen Teil an der gesunden Ernährung. „Da können wir uns etwas abgucken“, haben wir uns in der MEDICOM-Redaktion gedacht – und eine MEDICOM fast ausschließlich zum Thema Japan verfasst.
Petra Wons Vorstand der Medicom Pharma AG
So lange und gesund leben wie die Japaner? Natürlich, das möchten wir alle. Aber müssen wir deshalb rohen Fisch essen, Buddhisten werden und stundenlang in Stellungen verharren, die uns an Verrenkungen erinnern? Keineswegs. Wenngleich viele Dinge es vielleicht wert sind, einmal ausprobiert zu werden. Machen Sie sich einfach selbst ein Bild. Tauchen Sie ein in die Kultur des Landes der aufgehenden Sonne. Sie begegnen in dieser Ausgabe Teemeistern und Zen-Mönchen, lesen, was es mit schintoistischen Opfergaben und der Lebensenergie Ki (oder Qi) auf sich hat, und erfahren, warum die japanische Heilkunst so erfolgreich ist. Vielleicht interessiert es Sie, warum „kämpfen“ und „heilen“ für Japaner nicht in einem Widerspruch stehen, und Sie lernen die gewaltfreie Kampfkunst Aikido kennen. Wer war Buddha und wie lautet seine Lehre? Auf den Seiten 20/21 haben wir unter der Überschrift „Buddhismus – das einzig Beständige ist der stetige Wandel“ naheliegende Fragen zu einer der größten Religionen des Ostens beantwortet. Was ist das Nirvana? Was hat es mit der Wiedergeburt auf sich? Ist Buddha ein Gott? Lassen Sie sich von einer ungewohnten Sichtweise überraschen.
Vielleicht haben Sie sie auch schon gesehen, sei es bei einem Spaziergang durch den Park oder am Strand: „Schattenboxer“, Menschen, die sich mit seltsamer Langsamkeit um sich selber zu drehen scheinen und dabei sonderbare Positionen einnehmen. Tai Chi Chuan, Meditation in Bewegung. Ab Seite 29 erfahren Sie mehr über die Bewegungskunst. Wer Tai Chi Chuan praktiziert, lernt die Energie des Geistes zu bündeln und auf ein bestimmes Ziel hin auszurichten. Die Bewegungskunst gilt – neben vielen anderen Aspekten der japanischen Kultur – als eine Methode, die es den Japanern möglich macht, sehr lange gesund zu bleiben, und es gibt zahlreiche Studien, die die gesundheitsförderliche Wirkung belegen. All die Aspekte einer gesunden Lebensführung, die zu einem erfüllten und langen Leben der Menschen in Japan beitragen, wären natürlich nicht vollständig, wollten wir den langlebigen Japanern nicht in die Töpfe und auf die schön dekorierten Teller schauen. Der wahrscheinlich sogar ausschlaggebendste Aspekt für die gute und lange Gesundheit der Japaner ist die leichte, vitalstoffreiche und auch köstliche Küche. Lassen Sie sich ab Seite 32 inspirieren!
Inhalt
Titelthema: Japan
12
Ab Seite
Im Land des Lächelns lebt man länger Japaner haben die höchste Lebenserwar-
meister, schlendern
tung. Frauen werden im Durchschnitt 85
Sie durch die Straßen Tokios,
Jahre alt, Männer erreichen ein Durch-
und entdecken Sie dabei das japani-
schnittsalter von 78 Jahren. Woran liegt
sche Geheimnis des langen Lebens.
das? Die MEDICOM hat sich auf der Suche nach einem schönen, langen und gesunden Leben im Land der aufgehenden Sonne umgeschaut. Besuchen Sie die Zen-
Körper & Seele
20
Ab Seite
Buddhismus
Das einzig Beständige ist der stetige Wandel In Japan sind der Buddhismus und der Schintoismus
22
Was ist Buddhas Lehre?
Neues aus der Forschung:
4 4 5 5 6 7 8 8
Gesundheit & Recht Gerichtsurteile
die beiden Hauptreligionen. Was ist ein Buddhist?
Ab Seite
Kurzmeldungen Wir werden immer netter! Folsäure gegen Depressionen Zigaretten: Zusätze machen süchtig Gesundheits-Meldungen Enkel hüten und länger leben Gesündere Ernährung? Leider nein! Entzündliche Darmerkrankungen Alles klar mit Heidelbeeren
Soja
Länger gesund mit „pflanzlichen Hormonen“ Manche Pflanzen verfügen über Heilkräfte. Phyto-Östrogene, also pflanzliche Inhaltsstoffe, die ähnlich wie Östrogene wirken können, sind in Soja und in Leinsamen enthalten. Sie sind ideal gegen Wechseljahresbeschwerden.
Ab Seite
29
Bewegung & Fitness: Tai Chi Chuan Meditation in Bewegung Ein chinesischer Mönch beobachtete einst fasziniert den Kampf zwischen einer Schlange und einem Kranich. Wie daraus eine Bewegungskunst wurde, die es sich zum Ziel setzt, den Körper und die Seele zu vereinen, lesen Sie hier.
Essen und Trinken: Asia-Food Leicht, gesund und lecker. Die asiatische Küche vereint traditionell Gesundheitslehren und guten Geschmack. Gerade auch in der Esskultur liegt der Schlüssel zu einem langen und gesunden Leben.
Ab Seite
9
MEDICOM informiert Keine Chance für Salmonellen Himalaya-Salz: ohne Vorteile
10 11
Titelthema Japan: Im Land des Lächelns lebt man länger
12
Körper & Seele Buddhismus: Das einzig Beständige ist der stetige Wandel
20
Neues aus der Forschung Soja: Länger gesund mit „pflanzlichen Hormonen“
22
Vitalstoff-Lexikon Gamma-Linolensäure Omega-3-Fettsäuren
25 26
Bewegung & Fitness Tai Chi Chuan – Meditation in Bewegung
29
Essen & Trinken Asia-Food Vitalstoffrezept
32 37
Rubriken Editorial Impressum Leserbriefe Rätselseite
2 38 38 39
32 MEDICOM 27. Ausgabe, Dezember 2003
3
Wir werden immer netter!
FOTO: PHOTODISC
issenschaftler haben bewiesen, dass wir (entgegen der verbreiteten Ansicht) im Alter nicht mürrischer, sondern netter werden. Amerikanische Forscher haben jetzt in einer Studie über 130.000 Personen im Alter zwischen 21 und 60 Jahren auf fünf Persönlichkeitsmerkmale hin untersucht. Bis auf die Offenheit, die generell bei Frauen und Männern leicht abnahm, scheinen sich alle Merkmale zumindest bei einigen der untersuchten Gruppen mit dem Alter zu verbessern. Verträglicher werden die Menschen vor allem in den Dreißigern. Beim Neurotizismus (Emotionale Labilität) und bei der Extraversion (Aufgeschlossenheit) unterscheiden sich Frauen und Männer: Frauen werden allmählich weniger neurotisch und emotional labil, dafür aber in sich gekehrter. Männer dagegen verändern sich offenbar kaum in diesen beiden Punkten. Beide Eigenschaften, Neurotizismus und Extraversion, sind nach der Studie bei jungen Frauen deutlich stärker ausgeprägt als bei jungen Männern. Das würde bedeuten, dass sich die beiden Geschlechter in manchen Charaktereigenschaften mit zunehmendem Alter immer mehr angleichen. Die Ergebnisse wurden im Fachmagazin „Journal of Personality and Social Psychology“ (Mai 2003) veröffentlicht. Offenbar ändert sich die Persönlichkeit mit fortgeschrittenem Alter sogar noch mehr als vorher. Das lässt sich damit erklären, dass etwa ein stärkeres Pflichtbewusstsein und eine bessere emotionale Stabilität ein Ausdruck für eine höhere Reife einer Person sind, so die Forscher.
Eine Studie belegt: Vor allem in den Dreißigern werden die Menschen vertäglicher.
4
MEDICOM 27. Ausgabe, Dezember 2003
FOTO: PHOTODISC
W
Darum lieb´ ich alles, was so grün ist – weil es so reich an Folsäure ist ... Doch aufget: Folsäure ist das „Sensibelchen“ unter den Vitaminen. Langes Kochen und Warmhalten sind „Folsäure-Killer“, daher sind viele Menschen unterversorgt, was die Folsäure angeht.
Folsäure gegen Depressionen Forscher vermuten einen Zusammenhang zwischen dem Vitamin aus der B-Gruppe und geistiger Gesundheit
D
epressionen können mit einem Mangel an Folsäure oder einer gestörten Verwertung des Vitamins zusammenhängen. Norwegische Wissenschaftler fanden jetzt Hinweise für die Richtigkeit dieser schon länger bekannten These. Depressive Menschen haben häufig einen sehr hohen Spiegel der Aminosäure Homocystein im Blut. Folsäure fördert den Abbau dieser Aminosäure, weshalb viel Homocystein im Blut auf einen Mangel an Folsäure hindeutet. Die Fachzeitschrift „Archives of General Psychiatry“ (Bd. 60, S. 618) berichtet über eine Studie der Universität von Bergen in Norwegen, bei der bei knapp sechstausend Probanden die Blutkonzentration von Homocystein gemessen wurde. Tatsächlich waren die Studienteilnehmer, die hohe Konzentrationen an Homocystein im Blut hatten, doppelt so häufig depressiv wie die Personen mit den geringsten Mengen dieser Aminosäure. Einen weiteren Hinweis ergab eine DNAAnalyse. Bei den Menschen, die stark zu Depressionen neigten, war ein bestimmtes Gen verändert, das normalerweise eine wichtige Rolle im Folsäure-Stoffwechsel
spielt. Frühere Untersuchungen hatten bereits ergeben, dass Folsäure die Wirkung von Antidepressiva eindeutig verstärken kann. Auf welche Weise das B-Vitamin die Entstehung von Depressionen verhindern könnte, ist den Wissenschaftlern noch unklar. Möglich ist es, dass Folsäure an der Bildung bestimmter Substanzen im Gehirn beteiligt ist, durch deren Fehlen Depressionen und mentale Störungen ausgelöst werden. Die Wissenschaftler sehen in dem Studienergebnis die Bestätigung, dass Vitamine nicht nur für die körperliche, sondern auch für die geistige Gesundheit unentbehrlich sind. 90 Prozent der Deutschen sind jedoch unterversorgt, was Folsäure angeht. Besonders reich an Folsäure sind Spinat, grüne Erbsen, Grünkohl, Wirsing oder Rosenkohl. Wer diese Lebensmittel nicht häufig verzehrt, sollte zu Nahrungsergänzungsmitteln greifen, die Folsäure enthalten, um den Bedarf zu decken. Das gilt auf jeden Fall für Frauen mit Kinderwunsch und für schwangere und stillende Frauen.
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
Gesundheits-Meldungen ganz
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
Zigaretten: Zusätze machen süchtig Moderne Zigaretten enthalten mehr Suchtstoffe Nikotin macht vor allem in einer bestimmten Form süchtig, und die Zigarettenindustrie sorgt dafür, dass diese Form in hoher Konzentration in den Zigaretten enthalten ist.
N
ikotin kann in zwei verschiedenen Formen vorliegen. Die so genannte freie Form geht schnell vom festen Tabak in den Rauch über. Dadurch wird das Nikotin beim Rauchen unmittelbar in die Lunge und von hier ins Gehirn transportiert. Die andere Form des Nervengiftes, die so genannte protonierte Form, verdampft nur sehr langsam und kommt nur in geringen Mengen im inhalierten Rauch vor. Je schneller das Nikotin im Gehirn ankommt, desto stärker ist das Suchtpotenzial. Die Zusammensetzung der Zigarette bestimmt, wie viel Nikotin in der freien Form vorliegt, und damit, wie abhängig eine Zigarette macht. Diesen Faktor nutzen manche Tabakkonzerne aus und erhöhen durch Zusätze wie zum Beispiel Harnstoff die Menge an freiem also süchtig machendem Nikotin in ihren Produkten. Eine jetzt in der Online-Ausgabe der Fachzeitschrift „Chemical Research in Toxicology“ (Ausgabe Juli) veröffentlichte Studie bringt zum ersten Mal die erhöhte Konzentration freien Nikotins in modernen Zigaretten mit bestimmten Zusätzen
in Verbindung, die von der Zigarettenindustrie verwendet werden. Studienleiter James F. Pankow und sein Team von Chemikern entwickelten ein neues Verfahren, um die tatsächliche Menge süchtig machenden Nikotins im Zigarettenrauch zu messen. Die Wissenschaftler von der Oregon-Universität für Gesundheit und Wissenschaft fanden dabei deutlich höhere Konzentrationen des gefährlichen freien Nikotins, als bislang vermutet wurde. Die chemische Zusammensetzung und damit der Anteil an freiem Nikotin variierte zudem von Marke zu Marke. „Die Studie zeigt, dass das Nikotin in modernen Zigaretten genauso verändert wird wie Kokain bei der Crack-Herstellung“, kommentiert der Suchtexperte Jack Henningfield von der John-Hopkins-Universität das Untersuchungsergebnis. Die „moderne“ und extrem gefährliche Droge Crack besteht aus der „freien“ Form des Kokains, das ebenso wie das „freie“ Nikotin sehr viel schneller ins Gehirn gelangt als die „gebundene Form“ des Grundstoffs.
Jeder weiß es: Rauchen ist weit mehr als ein lästiges Laster. Es ist eine lebensbedrohliche Sucht. Dennoch zerstören täglich Millionen Raucher in Deutschland ihr Lungengewebe mit den tödlichen Sargnägeln.
FOTO: PHOTODISC, DPNY
Wunden heilen durch Schreiben Seine negativen Gefühle zu Papier zu bringen, lässt Hautwunden schneller heilen. Britische Psychologen wiesen in einer Studie nach, dass kleine Hautwunden derjenigen Probanden schneller verheilten, die regelmäßig über ihre negativen Gefühle bei einem aufregenden Ereignis schrieben. Das Schreiben über triviale Gefühle verhalf zu keiner schnelleren Heilung. + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
Schmerzmittel mit Bananen einnehmen Schmerzmittel sollten zusammen mit einem gut bekömmlichen Nahrungsmittel wie Bananen eingenommen werden, um die Magenschleimhaut zu schützen. Das Medikament wird dann zwar langsamer vom Körper aufgenommen, so dass sich die Wirkung erst später zeigt, Magenprobleme werden so aber vermieden. Viele Menschen reagieren mit Magenschmerzen auf die Wirkstoffe von Schmerzmitteln. + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
Krawatten lockerer binden Männer, die ihre Krawatten zu eng binden, riskieren eine Erkrankung der Augen. Zu enge Knoten erhöhen vermutlich den Augeninnendruck und steigern so das Risiko, an grünem Star zu erkranken. Wissenschaftler vermuten, dass der enge Schlips die Halsschlagader zusammenpresst und dadurch den Druck in dem Blutgefäß erhöht. Als +Folge + + + +davon + + + + steigt + + + + der + + +Augeninnendruck. + + + + + + + + + + + + + + „Frühstücker“ sind gesünder Der Verzicht auf das Frühstück ist ein Indiz für ein insgesamt ungesundes Leben. Forscher fanden heraus, dass „Frühstücksverweigerer” zu einem höheren Nikotin- und Alkoholkonsum tendieren und auch sonst wenig Wert auf ihre Gesundheit legen. Diejenigen, die auf die erste Mahlzeit verzichten, neigen bereits am Vormittag dazu, +ungesunde + + + + + + + Snacks + + + + + zu + + konsumieren. + + + + + + + + + + + + + + + Optimismus schützt vor Erkältungen Optimisten sind seltener verschnupft als notorische Griesgräme, und sie leiden auch an weniger schweren Symptomen. In einer Studie befragten Wissenschaftler die Teilnehmer nach ihrem Gemütszustand und sprühten ihnen danach eine Lösung mit Rhinoviren, den üblichen Erregern von Erkältungen, in die Nase. Menschen mit positiver Grundeinstellung litten danach seltener an Sympto+men, + + + die + + +auch + + + + + + + + + + +ausgeprägt + + + + + + + +waren. + + + + schwächer Werte wieder im Trend Nicht schicke Klamotten und viel Taschengeld schätzen Schulkinder an ihren Altersgenossen, sondern Freundlichkeit und Leistung. Wissenschaftler befragten Acht- bis Zehnjährige, wie sie sich selbst und andere einschätzen, welches Verhalten in der Gruppe besonders erfolgreich sei und welches sie selber für gut hielten. Ergebnis: Wer gute Noten hat, seine Kameraden begeistern kann, sportlich und freundlich ist, genießt das höchste Ansehen.
Enkel hüten und länger leben Forscher stellt neue Theorie zum Altern auf Eigentlich macht es biologisch gesehen und für die Erhaltung einer Art wenig Sinn, dass manche Lebewesen – einschließlich des Menschen – sich auch dann noch bester Gesundheit erfreuen, wenn sie keinen Beitrag mehr zur Fortpflanzung leisten.
M
enschen, Delfine und andere Säugetiere leben jedoch noch lange über ihre reproduktive Phase hinaus. Biologisch gesehen macht das, wie gesagt, wenig Sinn. Der amerikanische Forscher Ronald Lee von der University of California hat nun eine neue Theorie entworfen und gezeigt, dass nicht nur die Geburt der Kinder, sondern auch deren Aufzucht eine große Rolle spielt. An diesem Punkt kommen die älteren Generationen zurück in den evolutionären Kreislauf: bei der Pflege der Enkel. Die These: Je mehr sich die ältere Generation – sowohl beim Menschen als auch bei den Tieren – an der Aufzucht der Jüngsten beteiligt, desto älter werden die Senioren.
Als Beispiel nennt Lee Pilot-Wale. Diese Tiere pflegen ihren Nachwuchs intensiv – und zwar nicht nur die Kinder, sondern auch die Enkel. Die Wale leben sehr viel länger, als sie sich fortpflanzen können. Im Gegensatz dazu ist es für eine Art, die sich nach der Geburt überhaupt nicht mehr um den Nachwuchs kümmert, biologisch ausreichend, wenn sie nur so lange lebt, wie sie sich fortpflanzen kann. Wenn Eltern und Großeltern in der Aufzucht eine wichtige Rolle spielen, ist es für die Art sinnvoll, die Lebenszeit der Individuen zu verlängern. Diese Theorie ist auch für den Menschen anwendbar und erklärt das lange Leben von Senioren über ihre reproduktive Phase hinaus. Die Studienergebnisse wurden in der amerikanischen Fachzeitschrift „Proceedings of the National Academy of Sciences“ veröffentlicht.
FOTO: PHOTODISC
Die Studie: Mit einem neuen mathematischen Modell untersuchte der Spezialist für Demographie (Bevölkerungsentwicklung) den Zusammenhang zwischen der Lebenserwartung und der Fürsorge, die die Älteren den Kindern angedeihen ließen.
Das Fazit: Die Pflege des Nachwuchses bestimmt ganz wesentlich den Alterungsprozess der Senioren.
Wenn sich Opa um den Kleinen kümmert, profitieren beide. Enkel hüten hält nämlich nicht nur jung, sondern lässt den Senior auch älter werden.
ANZEIGE
Gesündere Ernährung? Leider nein! Der Trend zu gesunder Ernährung scheint vorläufig gestoppt zu sein. Zu diesem ebenso überraschenden wie bedauerlichen Ergebnis kam das GSF-Forschungszentrum für Umwelt und Gesundheit auf der Basis vier groß angelegter Studien zum Ernährungsverhalten in Deutschland.
V
on 1984 bis 2001 haben die Forscher das Ernährungsverhalten der Menschen im Raum Augsburg untersucht. Das Ergebnis: Der Trend zur gesunden Ernährung hatte seinen vorläufigen Höhepunkt bereits in der zweiten Hälfte der achtziger Jahre erreicht. Er hielt zwar bis 1995 weiter an, im Verlauf bis 2001 trat dann allerdings eine leichte Verschlechterung des Essverhaltens ein.
raum von 1984 bis 1990. Bis 1995 verbesserte sich das Verhalten nur noch leicht, danach verschlechterte es sich sogar. Leider kann man zudem davon ausgehen, dass diese Ergebnisse noch „geschönt“ sind. Studienteilnehmer geben erfahrungsgemäß eher Antworten in Richtung gesunder als in Richtung ungesunder Ernährung. Die Untersu-
An den vier Studien nahmen jeweils zwischen 4.000 und 5.000 Männer und Frauen im Alter von 25 bis 74 Jahren aus der Region Augsburg teil. In standardisierten Interviews wurden sie jeweils nach dem Verzehr von mehr als 20 verschiedenen Lebensmittelgruppen befragt. Danach bewerteten die Wissenschaftler die gemachten Angaben anhand der Empfehlungen der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE) zur Vorbeugung von Herz-Kreislauferkrankungen. „Täglicher Obstkonsum“ wurde zum Beispiel mit 2 Punkten bewertet, während „Obstkonsum seltener als einmal die Woche“ keinen Punkt erhielt. Die Summe aller Punkte ergab dann das Maß, anhand dessen das Ernährungsverhalten der Studienteilnehmer insgesamt bewertet wurde. Fazit: Die größten Veränderungen in Richtung einer gesünderen Ernährung erfolgten im Zeit-
chungsergebnisse sind von zentraler Bedeutung für das gesamte Gesundheitswesen, denn sie dienen auch als Grundlage für die Untersuchung der Zusammenhänge von Ernährung und einer ganzen Reihe von Erkrankungen. So zeigen sich seit längerer Zeit vor allem Zusammenhänge zwischen dem Konsum bestimmter Lebensmittel und HerzKreislauferkrankungen. Gerade auch deshalb bleibt zu hoffen, dass der Trend sich wieder in Richtung gesündere Ernährung wendet – oder dass zumindest die Defizite falscher Ernährung ausgeglichen werden. Wenn es manchen Menschen nicht gelingen mag, sich gesund zu ernähren, können Vitalstoffe zusätzlich mit einem guten Multivitalstoff-Präparat zugeführt werden. Das kann zwar keine gesunde Ernährung ersetzen, stellt aber eine Möglichkeit dar, dem Körper die lebensnotwendigen Vitalstoffe zuzuführen, ohne die ein Mensch krank wird.
Milch, einschl. Buttermilch
Fleisch und Wurstwaren
Geflügel
Schokolade, Pralinen
15-Jahres-Trend für den Verzehr ausgewählter Lebensmittelgruppen von 1984 bis 2001
Salat oder Gemüse, roh oder zubereitet
Vollkorn, Schwarz-, Knäckebrot Salzige Knabbereien wie gesalzene Erdnüsse, Chips etc.
Kartoffeln
GRAFIK: PHOTODISC, DPNY
7 Quelle: MONICA-/KORA-Projekt Augsburg, Querschnittsstudien 1984/85 und 1999/2001.
AUS DER NATUR
MEDICOM-TIPP
Entzündliche Darmerkrankungen – Vitamine und Mineralstoffe helfen
FOTO: PHOTODISC
ine Darmentzündung geht häufig mit einem Mangel an wichtigen Vitalstoffen einher. Patienten mit Morbus Crohn und Colitis ulcerosa sollten daher einmal jährlich ihr Blutserum auf den Gehalt von Zink, Eisen, dem Eisenspeicherprotein Ferritin und von Vitamin B12 untersuchen lassen, auch dann wenn sie keine akuten Beschwerden haben. Das empfiehlt die „Ärzte Zeitung“. Zudem leiden viele Menschen mit chronisch-entzündlichen Darmerkrankungen auch an einem Mangel an Calcium, Magnesium oder Folsäure. Das ärztliche Fachblatt gibt Tipps, welche Vitalstoffe im Blut kontrolliert werden sollten. Bei 25 bis 80 Prozent der Patienten liegt ein manifester Eisenmangel vor. 10 bis 40 Prozent der von chronisch-entzündlichen Darmerkrankungen Betroffenen fehlt Calcium, und 35 bis 60 Prozent der Patienten mit Morbus Crohn, aber nur fünf Prozent der Colitis-ulcerosa-Kranken haben einen Vitamin-B12-Mangel. 30 bis 65 Prozent der Patienten mit chronisch-entzündlichen Darmerkrankungen haben einen Folsäuremangel. 40 bis 55 Prozent der Patienten mit Morbus Crohn fehlt Zink. Mängel sind außerdem möglich bei den Vitaminen A, E, K und C oder bei Selen. Menschen, die unter entzündlichen Darmerkrankungen leiden, können die Vitalstoffe teilweise nicht richtig aufnehmen oder scheiden sie zu schnell wieder aus. Für Darm-Patienten empfiehlt es sich also auf jeden Fall, zu einem guten und ausgewogenen Multivitalstoff-Präparat zu greifen.
Menschen mit entzündlichen Darmerkrankungen sollten ihre Blutwerte auf Vitamin- und Mineralstoffmangel prüfen lassen.
8
MEDICOM 27. Ausgabe, Dezember 2003
FOTO: BRAND X PICTURES
E
Wer öfter mal „in die Beeren geht”, kann diese hinterher besser finden. Das gilt zumindest für Heidelbeeren. Die sind nämlich besonders gut für die Augen.
Alles klar mit Heidelbeeren Heidelbeeren, Blaubeeren, Bickbeeren – es gibt viele Namen für das leckere Beerenobst, das nur auf der nördlichen Halbkugel zu finden ist. Der Beerensucher weiß, dass die blaue Beere gut schmeckt, und vielleicht ist auch so manchem ihre Heilkraft bekannt.
S
o gilt die getrocknete Blaubeere als besonders wirksames Mittel, um Durchfall zu stoppen. Doch die Frucht des lateinisch als Vaccinium myrtillus bezeichneten Buschgewächses kann noch mehr. Die erstaunliche Wirkung von Heidelbeeren auf die Sehkraft hat man im zweiten Weltkrieg durch Zufall entdeckt. Britische Militärpiloten, die in der Notzeit oft Brote mit Heidelbeermarmelade zu essen bekamen, konnten nachts plötzlich besser sehen und wurden nicht mehr von der Fliegerabwehr geblendet. In den Sechzigerjahren haben dann Wissenschaftler in der Heidelbeere die Anthozyane entdeckt, den Hauptwirkstoff der blauen Farbe in der Heidelbeere. Es wurden Tests und Studien mit französischen Piloten durchgeführt. Die Ergebnisse waren sensationell. Sie bewiesen: Die Anthozyane in der Heidelbeere stärken die Sehkraft und helfen den Augen, gesund zu bleiben. Weitere Studien bewiesen: Wer regelmäßig Anthozyane aus
der Heidelbeere zu sich nimmt, kann bei Dunkelheit besser sehen. Auch bei der von Diabetes verursachten Retinopathie und bei der Makula-Degeneration, einer Erkrankung der Netzhaut, können die blauen Beeren helfen. Mit dem Essen von frischen oder tiefgefrorenen Heidelbeeren allein kann man allerdings keinen medizinischen Erfolg erzielen. Die Anthozyane müssen in extrem hohen Dosierungen verabreicht werden. Für 1 Gramm Wirkstoff muss ein ganzes Pfund wild wachsender Heidelbeeren verarbeitet werden. Da das nächtliche Sehvermögen altersbedingt ab dem 40. Lebensjahr abnimmt, sind Nahrungsergänzungen, die Heidelbeer-Extrakt enthalten, zu empfehlen. Das gilt besonders für Autofahrer, für ältere Menschen sowie für Menschen, die häufig an einem Monitor arbeiten, fernsehen oder lesen. Oft ist der Extrakt in Vitalstoffformulierungen enthalten, die speziell für die Bedürfnisse der Augen konzipiert wurden.
Kostenübernahme für Schwerbehinderte:
Nur für Grundbedürfnisse und medizinische Behandlung
Krankenkassen müssen nur die Kosten für Hilfsmittel für die medizinische Behandlung und für die Befriedigung von Grundbedürfnissen für Schwerbehinderte übernehmen. Dass Autofahrten nicht zu den Grundbedürfnissen zählen, zeigt die Entscheidung des Bundessozialgerichts, dass die Krankenkasse für einen schwerbehinderten Rollstuhlfahrer in der Regel keine Vorrichtung zum Einladen ins Auto bezahlen muss. Bundessozialgericht, Az.: B 3 KR 23/02 R
Keine permanente Überwachung von Säuglingen
IN SACHEN GESUNDHEIT
§
Bringt ein agier aufgrund seiner körperlichen Verfassung, z. B. durch einen Gips, ein erhöhtes Thromboserisiko mit, so kann der Pilot des Charterflugs den Fluggast zurückweisen. Er ist nicht dazu verpflichtet, vorher eingehend zu prüfen, ob die Konstitution des agiers vielleicht doch ausnahmsweise eine Beförderung zulässt. AG Bad Homburg, Az.: 2 C 331/02-19
§
Der Säugling konnte gerettet werden, der Atemstillstand löste jedoch einen Hirnschaden aus. Hierfür besteht jedoch kein Anspruch auf Schmerzensgeld oder Schadenersatz, da auch gelegentliches Spucken die Klinik nicht zur permanenten Überwachung verpflichtet. Oberlandesgericht München, Az.: 1 U 5651/00
Integration steht im Vordergrund:
Behinderte und nicht behinderte Kinder gemeinsam unterrichten
Das Sozialamt muss die Kosten für einen Unterrichtsbegleiter für ein behindertes Kind, das auf einer Grundschule für Nichtbehinderte unterrichtet wird, übernehmen. Dies wurde im Falle eines körperlich und geistig behinderten Kindes entschieden, dessen Eltern die Erlaubnis der Schulbehörde hatten, ihr Kind bei der Regelgrundschule anzumelden. Auch wenn diese Kosten auf einer Sonderschule nicht anfallen
• GERICHTSURTEILE IN SACHEN GE
FOTO: PHOTODISC
Kein Flug bei Thromboserisiko
GERICHTSURTEILE
würden – die integrative Unterrichtung behinderter und nicht behinderter Kinder steht hier im Vordergrund. OVG Rheinland-Pfalz,Az.: 12 A 10410/03
Allergieauslösende Bäume:
Nicht jeder kann einfach gefällt werden Kann ein Hausbesitzer beweisen, dass ein bestimmter, in der Nähe seines Grundstücks stehender Baum Allergien bei ihm auslöst, so darf dieser geschlagen werden, auch wenn der Baum wegen seiner Stärke eigentlich nicht gefällt werden dürfte. Befinden sich jedoch mehrere allergieauslösende Bäume in der Umgebung, kann kein Anspruch auf die Fällung des Baumes erhoben werden. OVG NRW, Az.: 8 A 5373/99
Löst ein bestimmter Baum eine Allergie bei ihm aus, so darf ein Hausbesitzer, der in der Nähe wohnt, dessen Fällung veranlassen – wenn er die Allergie beweisen kann.
ILLUSTRATION: NILS WASSERMANN
GERICHTSURTEILE IN SACHEN GESUNDHEIT •
Aus einem Urteil des Oberlandesgerichts München geht hervor, dass Kliniken nicht zur permanenten Überwachung von gesunden Säuglingen verpflichtet sind. In einem aktuellen Fall hatte ein Neugeborener am Tage der Geburt keine Auffälligkeiten, außer gelegentlichem Spucken, gezeigt. Am darauf folgenden Tag atmete der Junge nicht mehr, als die Krankenschwester nach 20-minütiger Abwesenheit zurückkam. GERICHTSURTEILE IN SACHEN GESUNDHEIT • GERICHTSURTEILE IN SACHEN GESUNDHEIT • GERICHTSURTEILE IN SACHEN GESUNDHEIT
Eine Haftung für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität können wir nicht übernehmen.
MEDICOM 27. Ausgabe, Dezember 2003
9
MEDICOM informiert
MEDICOM informiert
MEDICOM informiert
INFORMATIONEN FÜR KUNDEN DER MEDICOM PHARMA AG
r t e i m r o f in
Keine Chance für Salmonellen Sommer, Sonne, Hitze: Deutschland erlebte in diesem Jahr eine ungewöhnliche Schön-Wetter-Periode. Doch dieser „JahrhundertSommer“ hatte auch seine Schattenseiten. Denn bestimmte Krankheitserreger wie Salmonellen fanden gerade bei diesen hohen Temperaturen optimale Wachstumsbedingungen.
S
o machte denn auch ein Polterabend in Appenheim Schlagzeilen, bei dem gleich 70 Gäste durch den Verzehr infizierter Mettbrötchen an Salmonellose erkrankten.
Die Salmonellose – medizinisch: Salmonella enteriditis – äußert sich entsprechend mit plötzlichem Unwohlsein, heftigen Bauchschmerzen, wässrigen Durchfällen sowie Erbrechen und Kopfschmerzen; manchmal kommt auch Fieber hinzu. Die Brech-Durchfälle hören zumeist nach 2 bis 3 Tagen auf, spätestens jedoch nach einer Woche. So unangenehm die Symptome 10
MEDICOM 27. Ausgabe, Dezember 2003
27. AUSGABE, DEZEMBER 2003
Bei kleinen Kindern und Senioren ist dies auf die verminderte Produktion von Magensäure zurückzuführen, die beim gesunden Erwachsenen einen Großteil der Keime abtötet. Abwehrgeschwächte und Schwangere sind wegen ihrer schwachen Gesamtkonstitution empfänglicher für Salmonellen-Infektionen.
Wie es zur Infektion mit Salmonellen kommen kann ... Jährlich werden deutschen Gesundheitsbehörden mehr als 70.000 Fälle der meldepflichtigen Salmonellose mitgeteilt. Experten vermuten jedoch, dass die Dunkelziffer, d. h. die Zahl der Fälle, die nicht als Salmonellosen erkannt oder gemeldet werden, etwa 10-mal so hoch liegt. Denn Infektionsmöglichkeiten gibt es viele: Bestimmte Tierarten sind zumeist geringfügig mit Salmonellen infiziert. Diese Tiere dienen den Salmonellen als Wirt – also als Lebensraum –, sie selbst zeigen aber keine Krankheitssymptome. Als Wirtstiere kennt man Geflügel, Schweine, Rinder und Wild. Ein potenzielles Risiko besteht somit bei allen rohen Fleischarten (z. B. Tartar) und Frischwurstwaren (Zwiebelmettwurst), die von diesen Tieren gewonnen wurden. Infiziert können auch andere von diesen Tieren stammende Lebensmittel sein, wie z. B. rohe Eier und Rohmilch, sowie die aus diesen Rohstoffen hergestellten Produkte (z. B. Mayonnaise, Tiramisu, Softeis). Problematische Lebensmittel sind auch Gewürze, Tee, getrocknete Pilze, gekeimte Sprossen sowie Schalen- und Krustentiere und Sushi. Wird bei diesen Lebensmitteln jedoch penibel auf Hygiene und auf die richtige Zubereitung geachtet, geht von ihnen keine Gefährdung aus. Erst falscher Umgang mit diesen Lebensmitteln macht Salmonellosen möglich. Bedeutsam bei der Abwehr von Salmonellen ist die Aufrechterhaltung der so geFOTO: USDA/ScienceSource/OKAPIA
Wie schaden uns Salmonellen? Salmonellen sind stäbchenförmige Bakterien, die nach dem amerikanischen Bakteriologen Daniel E. Salmon (1850-1914) benannt wurden. Sie können sich sowohl unter Sauerstoffzufuhr (aerob) als auch bei Luftabschluss (anaerob) vermehren, dabei benötigen sie aber Temperaturen zwischen 10° C und 47° C. Obwohl man heute weit mehr als 2.000 Arten von Salmonellen kennt, wird die bei uns übliche Salmonellen-Erkrankung vor allem von zwei Erregern hervorgerufen: Salmonella enteritidis und Salmonella typhimurium. Die Salmonellen werden über infizierte Lebensmittel oder über das Trinkwasser aufgenommen. Sie verursachen dann im Dünndarm oder im oberen Dickdarm eine lokale Infektion, indem sie in die Zellen der Darmschleimhaut eindringen und diese durch die Freisetzung von Toxinen (Giftstoffen) schädigen.
MEDICOM informiert
In heißen Sommern leider sehr verbreitet: Die Salmonellen lieben die Wärme und können sich in Fleisch, Milch und Eiern vermehren.
für die Betroffenen sind – wenn streng auf einen Ausgleich der Flüssigkeitsverluste geachtet wird sowie auf den Mineralhaushalt, genesen die Patienten zumeist rasch. Bei bis zu 5 % aller Erkrankungen kann die Salmonellose allerdings einen schweren Verlauf nehmen mit hohem Fieber, Kollaps und Organschäden oder sogar tödlich enden. Zu den Risikogruppen gehören kleine Kinder, Schwangere, ältere Menschen und Abwehrgeschwächte. Während beim gesunden Erwachsenen etwa 10.000 bis 1.000.000 SalmonellenKeime notwendig sind, um eine Erkrankung hervorzurufen, reichen bei Risikopatienten schon bis zu 100 Keime aus.
MEDICOM informiert
nannten Kühlkette, also der durch-gängigen Kühlung vom Hersteller des Lebensmittels über die Lagerung beim Händler und im Haushalt bis hin zum endgültigen Verzehr. Nur bei dauerhafter, ausreichender Kühlung (unter 10 °C, am besten 6 °C) wird die Vermehrung der Salmonellen unterbunden. Werden rohe salmonelleninfizierte Lebensmittel dagegen ungekühlt aufbewahrt, verdoppelt sich die Zahl der Bakterien alle 15 bis 20 Minuten. Beim Grillfest oder auf dem Büfett im aufgeheizten Partyraum kann so über mehrere Stunden hinweg eine erhebliche Salmonellen-Belastung entstehen. Auch Einfrieren tötet die Salmonellen nicht ab, sondern inaktiviert sie nur vorübergehend. Auftauen von Tiefkühlgut sollte daher niemals im Warmen, sondern immer im Kühlschrank erfolgen, da sich die Salmonellen ansonsten stark vermehren.
MEDICOM informiert
… und
wie man sich dagegen schützen kann
Der beste Schutz gegen Salmonellose sind Hygiene und kühle Lagerung – nicht nur im Sommer, sondern während des ganzen Jahres. Denn Salmonellen sind nicht an Geruchs-, Geschmacks- oder sonstigen Veränderungen des Lebensmittels zu erkennen. Auch gibt es keine Impfung gegen Salmonellen, und eine überstandene Salmonellen-Erkrankung immunisiert den Körper nicht gegen weitere Infektionen. In der Küche sollte unbedingt auf penible Händehygiene geachtet werden – und Geschirrtücher und Spüllappen sollten so oft wie möglich gewechselt werden. Benutzte Küchengeräte sollten möglichst sofort gründlich mit heißem Wasser gereinigt werden. So verhindert man eine mögliche SalmonellenVerunreinigung von an sich unproblema-
Himalaya-Salz: ohne Vorteile Das so genannte Himalaya-Salz wurde durch das Buch „Wasser und Salz – Urquelle des Lebens“ als angeblich gesundheitsförderlich bekannt und hielt daher auch Einzug in Apotheken, Reformhän und Naturkostläden.
D
ie DGE (Deutsche Gesellschaft für Ernährung) weist jedoch in ihrer Zeitschrift „info“ (Ausgabe 04/03) darauf hin, dass das Himalaya-Salz keine gesundheitlichen Vorteile gegenüber dem üblichen Speisesalz (chemisch: Natriumchlorid) aufweist. Im Gegenteil: Die DGE hält viele Behauptungen des Buches für nicht wissenschaftlich belegt oder sogar für haltlos. Die Autoren beschreiben Himalaya-Salz (auch Kristallsalz genannt) als besonders wertvoll, da es aus einem der Urmeere stammt, 250 Mio. Jahre alt ist und angeblich eine breite Palette an Mineralstoffen enthält. Haushaltssalz (Natriumchlorid) kritisieren die Autoren dagegen als giftige und aggressive chemische Substanz. Jod und Fluor, wie sie heute in vielen Haushaltssalzen enthalten sind, werden außerdem als „hochtoxisch“ bewertet. Diese Behauptungen sind aber nicht haltbar. Auch Himalaya-Salz besteht zu 97 % aus Natriumchlorid, so DGE-info. Natrium kann somit keine schwerwiegende Schädigung hervorrufen, ansonsten müsste diese auch durch das HimalayaSalz erzeugt werden. Die Empfehlung der
Himalaya-Salz-Befürworter, Fertiggerichte leicht mit Himalaya-Salz nachzuwürzen, um die schädigende Wirkung des Natriumchlorids wieder aufzuheben, ist somit paradox und angesichts des ohnehin hohen Salzverzehrs der deutschen Bevölkerung abzulehnen. Da Natriumchlorid im Himalaya-Salz den Hauptgewichtsanteil ausmacht, ist laut DGE-info weiterhin anzuzweifeln, dass das Kristallsalz wirklich nennenswert zur Versorgung mit Mineralstoffen – einmal abgesehen von den Stoffen Natrium und Chlor – beitragen kann. Auch die anderen Behauptungen der Buchautoren erweisen sich als nicht haltbar: Sowohl Natrium als auch Chlorid üben im menschlichen Körper durchaus wichtige Funktionen aus, vor allem bei der Aufrechterhaltung der Flüssigkeitsverteilung in den Geweben. Von einer bedarfsgerechten Versorgung mit Speisesalz (6 g pro Tag) geht daher keine Gefährdung aus. Fluor spielt eine wichtige Rolle bei der Zahngesundheit, und durch die heute übliche Jodierung des Speisesalzes konnte die Anzahl jodmangelbedingter Schilddrüsenerkrankungen reduziert werden. Auch
MEDICOM informiert
tischen Lebensmitteln (Gemüse, Obst). Rohe bedenkliche Lebensmittel (Tartar, Sushi) oder aus rohen Zutaten hergestellte Speisen (Tiramisu, Mayonnaise) sollten immer am gleichen Tag verwendet werden, an heißen Tagen aber am besten ganz gemieden werden. Fleisch, vor allem Hackfleisch, bitte immer gut durchbraten, am besten mindestens 10 Minuten bei über 70 °C. Beim Garen in der Mikrowelle sollten lange Garzeiten gewählt und zurückbleibende „kalte Nester“ in den Lebensmitteln verhindert werden. Warme Speisen sollten nicht lange warm gehalten werden, sondern besser schnell abgekühlt und bei Bedarf wieder erhitzt werden. Und das Wichtigste, nicht nur an heißen Tagen: Lebensmitteleinkäufe immer sofort im Kühlschrank verstauen und dort gekühlt lagern und erst unmittelbar vor dem Verzehr herausnehmen – dann haben Salmonellen keine Chance.
gegen die Verwendung jodierter oder fluoridierter Speisesalze bestehen somit keine gesundheitlichen Bedenken. Zu kritisieren sind die Vertreter des Himalaya-Salzes aber besonders deshalb, weil sie der kristallinen Sole, einem bestimmten Aufguss des Himalaya-Salzes, eine positive medizinische Wirksamkeit bei Bluthochdruck nachsagen. Seit langem ist aber bekannt, dass bei mindestens 50 % aller Hypertoniker eine erhöhte Salzzufuhr das Bluthochdruckrisiko noch verstärkt. Bluthochdruckpatienten wird daher generell empfohlen, möglichst wenig, aber keinesfalls mehr als 6 g Kochsalz (Natriumchlorid) pro Tag zu verzehren. Aufgrund des hohen Natriumchloridgehalts des HimalayaSalzes ist Bluthochdruckpatienten deshalb auch vom Konsumieren der Sole dringend abzuraten. Zweifelhaft ist außerdem die angebliche Wirkung der Kristallsalz-Sole hinsichtlich des Säure-Basen-Haushalts. DGE-info weist darauf hin, dass der menschliche Organismus über effektive Puffersysteme verfügt, die ernährungsbedingte Schwankungen im Säure-BasenHaushalt ausgleichen und die kristalline Sole somit überflüssig machen. FOTO: DPNY
MEDICOM informiert
MEDICOM 27. Ausgabe, Dezember 2003
11
Im Land des Lächelns lebt man länger
Japaner haben die höchste Lebenserwartung der Welt. In diesem Jahr übersteigt die Zahl der Hundertjährigen erstmals die Marke von 20.000. Frauen werden in Japan im Durchschnitt 85 Jahre, Männer 78 Jahren alt. Auch die älteste Frau der Welt, die erst kürzlich gestorbene Japanerin Kamato Hongo, wurde 116 Jahre alt. Die ältesten Zwillinge der Welt, die 1892 ebenfalls in Japan geborenen Kin Sang und Gin San, geben auf die Frage, warum sie glauben, so alt und noch so gesund zu sein, die Antwort: Lachen und die richtige Ernährung.
30
35
40
45
50
Mali
Malawi
55
60
Sudan
65
70 Brasilien
FOTO: PHOTODISC
Alter in Jahren
Sierra Leone
Botswana
Südafrika
Indien
China
K
ulturschock Japan: So beschreiben viele ihren ersten Eindruck vom Land der aufgehenden Sonne. Die japanische Kultur ist für uns westliche Menschen nur sehr schwer verständlich. Viele Vorurteile haben diejenigen, die noch nicht dort waren. Japaner lächeln ständig, leben auf engstem Raum zusammen, sind Technikfanatiker, arbeiten bis zum Umfallen und im Rentenalter noch weiter und vertragen keinen Alkohol. Japaner rasen in hypermodernen, enorm schnellen Zügen durch ihre futuristischen Metropolen und finden dennoch die Zeit, sich vor jeder Tür die Schuhe auszuziehen. Wir wissen von buddhistischen Klöstern, schintoistischen Schreinen, von ebenso geheimnisvollen wie wirksamen Heilmethoden, und wir bringen auch einige obskure Riten, wie das essen lebendiger Tiere, mit dem alten und dem neuen Japan in Verbindung. Japaner denken und handeln anders als wir, und gerade das macht ihre Kultur so interessant für uns. Wir sind der Faszination Nippons in vielen Bereichen erlegen, so dass vieles Japanische Einzug in unseren Kulturkreis gehalten hat: die japanische Küche, die japanischen Religionen, die Heilkunst, die Kampfkunst, die Gartengestaltung, die Architektur und vieles mehr. Ihre Kultur scheint auch großen Einfluss auf die Lebenserwartung der Japaner zu haben: Sie leben gesünder und länger als wir. Für die derzeit heranwachsende Generation gilt das nicht gleichermaßen, denn viele haben sich von der gesunden Lebensweise ihrer Eltern verabschiedet. Die gute Gesundheit der Japaner kann keine genetischen Ursachen haben, denn Japaner, die in den USA aufgewachsen sind und die dortige Lebens- und
Esskultur übernommen haben, leiden unter genau den gleichen Erkrankungen wie die Amerikaner. Das sind zum großen Teil die typischen Zivilisationskrankheiten der westlichen Welt, wie beispielsweise Herz- und Darmerkrankungen. Die Langlebigkeit im Land des Lächelns wird den Japanern demzufolge nicht in die Wiege gelegt, sie muss vielmehr in der Kultur begründet liegen. Die Quelle der japanischen Kultur ist die Tradition. Japaner kehren immer wieder in die Vergangenheit zurück, um sich zu vergewissern, wer sie sind. Alt hergebrachte und oft über Jahrhunderte unveränderte Zeremonien prägen zwar den Alltag nicht unmittelbar, aber doch das Leben eines jeden Japaners, seien es die Teezeremonien, die traditionellen Sportarten wie Aikido und Bogenschießen, die Religionen oder das Theater und das Puppenspiel. Die japanische und die chinesische Kultur sind übrigens – trotz vieler vermeintlicher Ähnlichkeiten für uns Europäer – völlig unterschiedlich. Viele japanische Traditionen haben zwar ihren Ursprung in der chinesischen, der indischen oder der koreanischen Kultur, doch sie haben sich im Laufe von Tausenden von Jahren mit anderen Einflüssen vermischt und weiterentwickelt. Das gilt ebenso für die Sprache, die nur noch in den Schriftzeichen der chinesischen ähnlich ist. Die Niederlage im zweiten Weltkrieg zwang Japan, sich dem Westen zu öffnen; auch das hat großen Einfluss auf die japanische Kultur genommen. Trotz all der modernen westlichen Attribute ist es falsch, die Japaner als westlich zu
bezeichnen. Auf den folgenden Seiten wollen wir versuchen, einige Teilbereiche dieser jahrtausendealten Kultur zu beschreiben. Uns geht es dabei vor allem darum, herauszufinden, warum die Japaner gesünder sind als wir. Vieles muss daher leider unangesprochen bleiben. Nehmen Sie´s bitte mit der Gelassenheit der buddhistischen Mönche.
Ki, die universelle Lebensenergie Die Japaner orientieren sich an der Lebensenergie Ki (sprich: Tschie). Ki (chinesisch Qi), das man als strömende Lebenskraft beschreibt, ist überall in der Natur und im Universum vorhanden und zeigt sich in allem Lebendigen in Form von Veränderung und Bewegung. Gemäß dieser Vorstellung ist jeder Lebensvorgang, jede Organfunktion Ausdruck des Wirkens und der Bewegung des Ki. Ohne Ki gibt es keine Bewegung, keinen Gedanken, keine Emotionen und kein Leben. Und obwohl Ki alles durchdringt und alles umfasst, lässt es sich nicht konkret beschreiben oder definieren. Bildlich gesehen kann man sich das Ki wie einen ständig fließenden Wasserfall vorstellen, der alles umgibt und alles durchdringt. Auch in der traditionellen japanischen und chinesischen Medizin verwendet man den Begriff Ki, um die Lebensenergie im Körper zu beschreiben. So kommt der Begriff auch in den Namen der Heilmethoden wie z. B. Reiki vor. Auf der Beherrschung und Lenkung des Ki beruhen auch alle östlichen Meditations- und Kampftechniken wie Tai Chi Chuan oder Aikido. Über Ki werden Sie im folgenden Text noch einiges lesen.
Länder mit der höchsten Lebenserwartung 77 Großbritannien
USA
78
79
Niederlande
Belgien
Neuseeland
Deutschland
Österreich
Spanien
80
81
Schweiz
San Marino
Frankreich, Italien
Australien, Schweden
Japan 81,4 13
Jenseits der Grenzen des Verstandes
I
n Japan koexistieren friedvoll drei große Religionen: der Zenbuddhismus, der Schintoismus und, als kleinste religiöse Gruppierung, das Christentum. Viele Japaner haben einen sehr pragmatischen Bezug zu diesen Religionen entwickelt und gehören oft den beiden verbreitetsten Glaubensrichtungen gleichzeitig an, ohne dies auch nur im geringsten als widersprüchlich zu empfinden. Festliche Anlässe wie Hochzeiten und Jubiläen werden vor allem schintoistisch gefeiert, und auch Bitten um Gesundheit, Glück und Wohlergehen werden in schintoistischen Schreinen vorgebracht. Begräbniszeremonien werden dagegen meist nach buddhistischem Ritus abgehalten, da der Buddhismus mit seiner Verheißung von Wiedergeburt besonders tröstlich und bestärkend wirkt. Dies spricht für einen positiven, am Nutzen orientierten Umgang der Japaner mit Religion. Die Gläubigkeit kann einer der Gründe für ihre Langlebigkeit sein, denn auch in unserem Kulturkreis ist bekannt, dass religiöse Menschen länger gesund bleiben. Lesen Sie hier eine kurze
Darstellung der beiden japanischen Hauptreligionen. Mehr zum Thema Buddhismus lesen Sie auf Seite 20/21.
Zenbuddhismus Zen (sprich: senn, japanisch für: Versenkung) ist die japanische Richtung des Buddhismus. Der Buddhismus kam aus China nach Japan. Zen versteht sich als die Konzentration auf das Wesentliche, nämlich auf die Meditation und das achtsame Handeln im Alltag. Der Zenbuddhismus verzichtet auf Theorien und Dogmen. Der Legende nach entstand diese besondere Form der Lehre aus der historischen Lehre des Buddhismus, als Buddha eine Predigt hielt und von seinen Schülern mit Fragen bestürmt wurde. Er lächelte nur und hielt schweigend eine Blüte hoch. Damit versinnbildlichte er, dass es nicht um Theoretisches geht, das intellektuell zu vermitteln ist, sondern um das Wesentliche: die Achtung und den Respekt vor dem Wesen der Dinge und Lebewesen: die Liebe. Nur ein Schüler begriff, was sein Meister damit sagen wollte, und wurde erleuchtet.
Diese „Herz-zu-Herz-Kommunikation“ ist im Zen sehr wichtig, schriftliche Überlieferungen spielen keine solch entscheidende Rolle wie in anderen Richtungen des Buddhismus. Der Zenbuddhismus zeichnet sich durch eine Spiritualität aus, die sehr alltagsverbunden ist. So ist das Tun an sich bedeutsam, weil es uns die Möglichkeit gibt, ganz darin aufzugehen und auf diese Weise das Einssein mit allem zu erfahren. Daher gelten die Teezeremonie oder das Bogenschießen auch als Meditation. Eine andere Form der Versenkung ist die Meditation über paradoxe Rätsel, die nicht mit dem Verstand zu lösen sind, sondern – ganz im Gegenteil – dem Verstand seine Grenzen aufzeigen sollen. Ein Beispiel: Wie hört sich das Klatschen der linken Hand an?
Schintoismus Die ursprüngliche Religion der Japaner ist der Schintoismus, der „Weg der Götter“. Es gibt 800 Myriaden Gottheiten, die verehrt werden. Schintoisten verehren die Natur und die Geister ihrer Ahnen. Diese Religion hat keine Gründer, ihre Anfänge liegen in der japanischen Vorzeit. Es gibt keine offiziellen heiligen Schriften und kein Lehrsystem. Die schintoistische Praxis besteht in Opfergaben und Riten vor öffentlichen Schreinen oder privaten Hausaltären. Diese sollen die Ahnen und die Geister gnädig stimmen. Der Schintoismus fordert Pflichttreue und Selbstbeherrschung.
FOTOS: PHOTODISC, DIGITALVISION, TONY STONE
Glaubt man US-amerikanischen Forschern, dann sind die Buddhisten die glücklicheren Menschen. Studien ergaben: Buddhisten lassen sich weniger schnell schockieren oder überraschen und regen sich seltener auf. Das soll an der Meditation liegen.
14
„
Für die Teezeremonien wird ein spezieller Tee verwendet, der Matchatee. Er wird unter besonderen Umständen kultiviert und auf andere Weise zubereitet als normaler grüner Tee.
as Ritual der japanischen Teezeremo-
nie hat seinen Ursprung in der Kultur der Zen-Klöster. Während der etwa vierstündigen Teezeremonie (chadô) wird in der Gegenwart des Gastes in ritueller Form grüner Tee zubereitet und serviert. Zu einer vollständigen Teezeremonie gehören eine kleine Mahlzeit und das zweimalige Servieren von Tee. Es ist die Aufgabe des Gastgebers, eine Atmosphäre zu schaffen, in der seine Gäste einen ästhetischen und sinnlichen Genuss sowie geistigen Frieden erleben können. Die tiefgründige Schönheit sehr einfacher Dinge, wie sanftes Kerzenlicht, der Klang des Wassers oder das Glühen eines Holzfeuers, sollen dabei helfen. Die Zeremonien werden in kleinen, hübsch gestalteten Räumen und Gärten von Teehän durchgeführt. Nicht nur der Gastgeber, sondern auch die Gäste einer Teezeremonie müssen mit der Demonstration von Bescheidenheit ihren Teil zur Harmonie beitragen. Der Teeweg ist einer der Wege des Zenbuddhismus, den Menschen in Einklang mit der Natur zu bringen. Menschen auf dem Teeweg lernen, sich in ihrer Lebenszeit auf die wesentlichen Dinge zu konzentrieren. Auf die Weise, wie sie dem Gast die Schale mit Tee reichen und wie dieser sie entgegennimmt, setzen sie gegen Unordnung und Wirrnis eine lebendige Harmonie. Die Philosophie des Teeweges ist eine Synthese von östlicher Kultur und religiösen Traditionen. Ein Grund, weswegen Mönche mit Tee meditieren, ist auch dessen anregende Wirkung. Er hält bei den oft langen
FOTOS: PHOTODISC
“
Sen nô Rikyû (1522 bis 1591) Vollender des Teeweges
– der Teeweg
D
In meinen Händen halte ich eine Schale Tee. Seine grüne Farbe ist ein Spiegel der Natur, die uns umgibt. Ich schließe meine Augen, und tief in mir finde ich die grünen Berge und das klare Wasser der Quellen. Ich sitze allein, werde still und fühle, wie all dies ein Teil von mir wird.
Meditationen wach. Für die Teezeremonie wird ein grüner Pulvertee verwendet, der Matchatee. Der Tee wird mit heißem, aber nicht kochendem Wasser aufgegossen und mit einem pinselähnlichen Bambusbesen ein paar Sekunden lang geschlagen, bis das Pulver sich auflöst und an der Oberfläche ein grünlicher Schaum entsteht. Der Schaum verleiht dem Tee sein besonderes Aroma. Anders als beim Trinken des gebrühten Tees werden beim Trinken dieses Pulvertees alle in den Blättern enthaltenen heilsamen Wirkstoffe, einschließlich des Koffeins, ganz aufgenommen. Der Matchatee hat einen starken Geschmack und wirkt sehr anregend. Die lange Tradition des Trinkens von grünem Tee ist mit Sicherheit ein Aspekt der guten Gesundheit der Japaner. Denn – einmal von seinen meditativen Qualitäten abgesehen – ist der grüne Tee schon immer als Heilmittel gegen viele körperliche Leiden bekannt gewesen. Die wissenschaftliche Forschung weiß schon seit längerer Zeit, dass seine Inhaltsstoffe gegen die verschiedensten Erkrankungen wie Krebs, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Infektionen, Magenerkrankungen und Karies wirken. Die wertvollen Inhaltsstoffe des grünen Tees sind auch in hochwertigen Multivitalstoffpräparaten enthalten.
Neue Forschungsergebnisse Mechanismus der Krebsvorbeugung entschlüsselt Wie grüner Tee die Krebsentstehung vermindert, das haben amerikanische Wissenschaftler jetzt herausgefunden. Ein Botenprotein wird dabei von den Inhaltsstoffen des grünen Tees blockiert. Zahlrei-
che Studien hatten bereits gezeigt, dass grüner Tee bestimmten Krebsarten vorbeugen kann. Wie das funktioniert, haben die Wissenschaftler um Christine Palermo von der Universität von Rochester in einer neuen Studie herausgefunden, die in der Fachzeitschrift „Chemical Research of Toxicology“ veröffentlicht wurde. Um hinter den Wirkungsmechanismus zu kommen, untersuchten die Forscher verschiedene Inhaltsstoffe eines TeeExtraktes und identifizierten zwei hauptverantwortliche Bestandteile und ihre Strategie. Wenn krebserregende Stoffe wie Tabakrauch oder Dioxin in den Körper gelangen, wird ein bestimmtes Eiweißmolekül aktiviert, das die krankmachende Wirkung dieser Stoffe im Körper hervorruft. Zwei Substanzen aus dem Tee-Extrakt fangen diesen Botenstoff ab und verhindern so die Entstehung von Krebs. Die beiden Substanzen, EGCG und EGC, finden sich außer im grünen Tee auch in Weintrauben und im Rotwein. Diese sekundären Pflanzenstoffe haben eine hohe antioxidative Wirkung und machen Freie Radikale unschädlich. Zahlreiche Studien belegten bereits, dass in Ländern, in denen regelmäßig viel grüner Tee getrunken wird, weniger Menschen an Krebs erkranken. Bisher nahm man an, dass die krebsvorbeugende Wirkung ausschließlich auf der antioxidativen Wirkung beruht. Die vorliegende Studie beweist jedoch, dass grüner Tee noch über weitere und zusätzliche Wirkungsmechanismen gegen Krebs verfügt. In den westlichen Ländern mag man oft den leicht herben Geschmack des grünen Tees nicht. Wer grünen Tee nicht mag oder nur sehr selten trinkt, aber dennoch von dessen krebsvorbeugenden Eigenschaften profitieren will, der kann zu Nahrungsergänzungen greifen, die
15
FOTOS: DIGITALVISION
Das Ki, die Lebensenergie, die durch die Meridiane des Körpers fließt, wird durch Berührung und mit sanftem Druck positiv beeinflusst.
– asiatische Medizin Die Philosophie
Shiatsu: sanfter Druck gegen den Schmerz
In der asiatischen Medizin trennen Ärzte den Körper nicht vom Geist. Der Mensch wird in der Wechselbeziehung zwischen Körper und Seele betrachtet. Gesundheit stellt ein Gleichgewicht der Kräfte dar, während Krankheit eine Störung dieser Ausgeglichenheit ist. In einem gesunden Organismus durchströmt die Lebensenergie Ki (auch Qi, gesprochen: Tschie) ungehindert den Körper auf unsichtbaren Kanälen. Gerät dieser Fluss ins Stocken, wird also das Gleichgewicht gestört, zum Beispiel durch Stress, falsche Ernährung, Klimaeinflüsse oder Emotionen, dann wird der Mensch krank. Möchte man Krankheiten heilen, so muss man „entstören“, d. h. die Ordnung wiederherstellen. Mit Hilfe von verschiedenen Techniken wie zum Beispiel Shiatsu (japanische Druckmassage, Akupressur) oder Reiki (Handauflegen) kann man den Energiefluss wieder in Gleichklang bringen. Lesen Sie hier über die Grundprinzipien dieser beiden japanischen Heilkünste. Japaner nutzen diese Techniken auch vorbeugend, damit es gar nicht erst zu Krankheiten kommen kann.
Geplagt von Kopfschmerzen drücken wir „automatisch“ mit den Fingern auf die Schläfen oder massieren die Stirn. Und meist tritt dann auch Erleichterung ein. Ohne es zu wissen wenden wir dabei eine Technik an, die ihren Ursprung in Asien hat: Shiatsu. Shiatsu ist eine seit über 2.000 Jahren bekannte Form der Druckmassage, die in Selbst- oder Fremdbehandlung ausgeübt werden kann und auf sanfte Art und Weise Beschwerden und Krankheiten lindert. Durch Shiatsu können sich Blockaden auflösen, sowohl im körperlichen als auch im seelischen Bereich. Solche Blockaden können sich sowohl als Verspannungen, Bewegungseinschränkungen oder schmerzende Bereiche im Körper zeigen als auch als Niedergeschlagenheit oder innere Anspannung. Die Harmonisierung des Energieflusses führt zu Entspannung und innerer Ruhe sowie zu einer verbesserten Körperwahrnehmung und zu einem besseren Körpergefühl. Shiatsu dient der Erhaltung der Gesundheit und regt bei Beschwerden die Selbstheilungskräfte an.
Extrakte des grünen Tees enthalten.
Östliche Lehren verstehen Krankheit auch als Reinigung, als Entwicklungsmöglichkeit des Individuums. So betrachtet wird der Krankheit auch die Schwere und die Unausweichlichkeit genommen. Wer Krankheit als Entwicklungsprozess versteht, kann sie annehmen und sie, wenn es an der Zeit ist, auch wieder ablegen. Eine sehr gesunde und weise Einstellung.
16
Reiki: Heilen durch Handauflegen Wie Shiatsu, so beseitigt auch Reiki Störungen im Energiefluss in den so genannten Meridianen. Durch jahrhundertelange Beobachtung haben die Chinesen ein „Kanalsystem“ mit 12 Hauptleitbahnen (Meridianen) ausgemacht, die alle
inneren Organe miteinander verbinden. Die Japaner haben diese Lehre von den Chinesen übernommen. Sechs Kanäle verlaufen von oben nach unten, sechs entgegengesetzt von unten nach oben. Zahlreiche weitere Meridiane verbinden die Kanäle untereinander. Vorstellen kann man sich das ähnlich wie Blutbahnen, nur dass in den Meridianen kein Blut fließt, sondern dass dort die Zirkulation der Energie – des Ki – stattfindet. Mittlerweile ist auch die moderne Wissenschaft in der Lage, Meridiane mit Hilfe von bioelektrischen Geräten zu messen. Reiki nimmt wie Shiatsu Einfluss auf Störungen im Energiefluss. Der Therapeut legt dazu seine Hände in bestimmter Reihenfolge auf die Energiepunkte der Meridiane. Wie Reiki genau wirkt, ist nicht bekannt. Es gibt aber diverse Erklärungen. Fest steht, dass beim Auflegen der Hände die meisten Menschen eine wohltuende Wärme verspüren, die sich schließlich im ganzen Körper ausbreitet. Diese Wärme aktiviert die Selbstheilungskräfte im Körper und vermag so, Krankheiten zu heilen. Reiki wird nicht nur als Behandlungsmethode verstanden, sondern auch als spiritueller Weg. Dessen Regeln lauten wie folgt.
Gerade heute ärgere dich nicht. Gerade heute sorge dich nicht. Ehre deine Eltern, deine Lehrer und die Älteren. Verdiene dein Brot ehrlich. Empfinde Dankbarkeit für alles Lebendige.
– Geist und Körper vereint Heilen und kämpfen (beschränkt auf die Kampftechnik, nicht auf deren Anwendung) stehen in japanischer Sichtweise zueinander wie Tag und Nacht. Beides ist, vertieft betrachtet, von gleicher Natur. Es bedingt sich gegenseitig, eins kommt ohne das andere nicht aus. Aikido, Judo und Kendo sind so genannte Zen-Kampfkünste. Übungen wie Aikido oder der Schwertkampf Kendo stehen in der Tradition der berühmten Samurai. Wir möchten Ihnen hier die reine Selbstverteidigungs-Kunst Aikido vorstellen.
Aikido, der Weg der Harmonie Ai-Ki-Dô ist ein Weg (Dô), die Lebensenergie (Ki) in Harmonie (Ai) zu bringen, deren Störung die Japaner als Ursache von Erkrankungen sehen. Aikido wird oft auch als „Lehre des harmonischen Weges“, oder „Kunst der gewaltlosen Selbstverteidigung“ bezeichnet. Der Sport lehrt den achtsamen Umgang mit dem anderen, der als Partner für die eigene Entwicklung dient. Der Trainingspartner bringt seine Energie in Form eines Angriffes ein. Diese Energie nimmt
„
Gewaltlosigkeit ist für unsere Gattung Gesetz, so wie Gewalt für das Tier Gesetz ist. Der Geist des Tieres ist unterentwickelt, und das Tier kennt kein anderes Gesetz als das der physischen Kraft. Dem Menschen gebietet seine Würde, einem höheren Gesetz, der Kraft des Geistes zu folgen.
Ueshiba Morihei Begründer des Aikido
der Angegriffene an und neutralisiert sie durch bestimmte Techniken. Erlösung aus dieser tänzerisch anmutenden Bewegung wird dem Angreifer dadurch zuteil, dass er sich der Führung des Verteidigers hingeben und sich letztendlich fallen lassen muss. Aikido beinhaltet Elemente verschiedener anderer japanischer Kampfsportarten. Die Philosophie des Aikido wendet sich jedoch gegen jede Form von Gewalt. Es ist eine Art der Selbstverteidigung, die Rücksicht nimmt auf das Recht der körperlichen Unversehrtheit eines jeden Menschen – auch auf die eines Angreifers. Im Aikido werden keine „Wettkämpfe“ durchgeführt. Es gibt keine Gegner, die es zu besiegen gilt. Es handelt sich immer um Partner, die einen gemeinsamen Weg beschreiten und sich dabei gegenseitig helfen. Eine solche Sichtweise führt zu einem geringeren Aggressionspotenzial und einem schöneren und gesünderen Leben. Denn wie auch westliche Forscher inzwischen bewiesen haben: Ärger und Aggressionen, aber auch das Gefühl, schutzlos allen Angriffen von außen ausgeliefert zu sein – das macht krank.
Der Begründer des Aikido, Meister Ueshiba Morihei. Er hat dem Ausübenden seiner Kampfkunst kategorisch jede Form aggressiven Verhaltens verboten: aus Achtung vor dem Leben.
“ FOTOS: FOTOSEARCH.COM, ALEXANDER T. IHLER
„Der Geist ist willig, allein, das Fleisch ist schwach“: Im westlichen Kulturkreis ist es eine selbstverständliche und unstrittige Annahme, dass Geist und Körper unabhängig voneinander existieren und sich mitunter im Weg stehen. Selbst wenn wir der Ansicht sind, dass dies gar nicht so sei, fällt es uns westlichen Menschen oft schwer, uns als Einheit zu verstehen. Japanern fällt dies leichter, doch sie arbeiten auch viel daran, den Körper mit dem Geist zu vereinen. Zum Beispiel soll durch Bewegung die innere Harmonie zwischen den beiden Aspekten hergestellt werden. Und dies soll zu Gesundheit, Langlebigkeit und allgemeinem Wohlbefinden führen. Ein Hauptziel der östlichen Kampfkünste und Kampfsportarten ist es, den Körper wieder zu seiner ursprünglichen Beweglichkeit zurückzuführen, einer Natürlichkeit, die wir als Kinder besaßen, die wir im Laufe der Jahre verloren haben. Spricht man von Gesundheit im Zusammenhang mit Kampfkunst, dann klingt das für westliche Ohren befremdlich, denn Kampfkunst wird mit kämpfen, verletzen oder gar töten in Verbindung gebracht. Japaner sehen dies anders.
17
auch in der Nahrung Schöne neue Welt: Technik und Gesundheit – ja bitte Japan – Kultur der Gegensätze. Auf der einen Seite das Land der Teezeremonien, der Meditation und des schintoistischen Geisterglaubens - auf der anderen Seite Hochtechnologie in allen Sparten. Das Roboterhündchen Aibo von Sony kann per Schwanzwedeln Gefühle ausdrücken und Honda-Roboter P3 gibt die Computerhand. Japanische Jugendliche sind ohne ihr Handy nahezu nicht lebensfähig, und sie spielen beinahe jede Lebenssituation per Computerspiel nach. Auch die Optimierung der Ernährung ist in Japan selbstverständlich. Functional Food sowie mit Vitaminen und Vitalstoffen angereicherte Nahrungsmittel gehören im Land der technikfreundlichen und gesundheitsbewussten Japaner zum Alltag. Bereits seit 1991 vergibt das japanische Gesundheitsministerium das Prädikat FOSHU (Food for specified health use, zu deutsch: Lebensmittel mit speziellem gesundheitlichem Nutzen). Kein Wunder also, dass es im Land der Entdeckung des
Coenzyms Q10 für Japaner an der Tagesordnung ist, sich dieses nur wenig in der Nahrung enthaltene Q10 per Nahrungsergänzung zuzuführen. In den 70er Jahren wurde in Japan eine Technologie entwickelt, mit der Coenzym Q10 fermentativ hergestellt werden kann. Lange Zeit konnte es nur aus Rinderherzen gewonnen werden, was schwierig und kostenintensiv war – ein Gramm kostete zu dieser Zeit 1000 Dollar. Jetzt steht Q10 in ausreichender Menge und zu erschwinglichen Preisen zur Verfügung. Ganz sicher ist die konsequente Ergänzung der Nahrung mit Q10 und anderen Vitalstoffen ein Faktor, der seinen Beitrag zur Langlebigkeit und der langen Gesundheit der Menschen in Japan leistet. Die Japaner nutzen auch hochdosierte Coenzym Q10-Präparate, um die in klinischen Studien nachgewiesenen therapeutischen und präventiven Wirkungen zu erzielen. Vor allem als wirkungsvoller Schutz vor Herzerkrankungen und Arteriosklerose hat sich Coenzym Q10 in hoher Dosierung bewährt. In den west-
lichen Nationen gehören Herzkrankheiten zu den Haupttodesursachen. Dabei ist Coenzym Q10 auch in Deutschland erhältlich - nur nicht so weit verbreitet wie im gesundheitsbewussten Japan. Ab dem 40. Lebensjahr kann der Körper Q10 nicht mehr so gut selbst herstellen und ist auf von außen zugeführtes Q10 angewiesen. Das macht eine ausreichende Zufuhr des Vitalstoffes ab diesem Alter sinnvoll. Auch für sportlich Aktive oder Menschen, die Medikamente einnehmen müssen, ist eine zusätzliche Versorgung mit Vitalstoffen zu empfehlen. Umweltbelastungen durch Ozon und Smog erhöhen den Vitalstoffbedarf zusätzlich. Unausgewogene Ernährung, Diäten, Appetitmangel und Verdauungsschwierigkeiten behindern ebenfalls eine gute Vitalstoffversorgung. Sollten Sie einer oder mehreren dieser Belastungen ausgesetzt sein, so ist eine zusätzliche Versorgung mit Vitalstoffen sehr empfehlenswert. Auch wenn Sie Alkohol oder Nikotin konsumieren, ist es empfehlenswert, Ihre Vitalstoffzufuhr zu verbessern.
FOTOS: TONY STONE , PHOTOS.COM
Die technikverliebten Japaner sind mit ihren Erfindungen noch lange nicht am Ende. Für die von der Regierung veranstalteten „RoboterWettbewerbe“ verbringen Kinder und Jugendliche oft ihre gesamten Ferien damit, einen Roboter zu bauen.
18
FOTOS: TONY STONE , FOTOSEARCH.COM, MARKUS JASER - WWW.JAPAN-FOTOGALERIE.DE
Tradition und Moderne. Für Japaner scheint das keinen Gegensatz darzustellen. Traditionelle Geishas und JapanGirlies, schintoistische Schreine und futuristische Schlafröhren, reglementierte Teezeremonien und sexuelle Freizügigkeit - in Japan geht das alles .
: Unerklärlich!
Japan in Kürze Offizieller Name: Nihon
Welcome to Japan. Please respect the rules. (Willkommen in Japan. Bitte beachten Sie die Regeln.) So steht es auf einem Begrüßungsschild für ausländische Gäste am Flughafen von Tokio zu lesen. Welche Regeln zu beachten sind, wird allerdings nicht erklärt. Sie haben jetzt viel über die gesunden und positiven Einflüsse der japanischen Kultur gelesen. Die japanische Gesellschaft befindet sich jedoch schon seit längerer Zeit in einem Wandel. Die Traditionen der Eltern gelten für die jüngeren Japaner (berechtigterweise, denn die Welt verändert sich) nicht mehr. Es ist stark zu bezweifeln, dass die Jugendlichen, die sich zunehmend mehr für Fast Food aus dem Westen interessieren und zum Beispiel den westlichen Trend übernommen haben, ihre Haut in der Sonne zu verbren-
nen, zu den ältesten Menschen der künftigen Generationen zählen werden. Für unser Verständnis sind Japaner auch skurril: Wussten Sie, dass sich japanische Rettungssanitäter vor dem Wiederbeleben eines Opfers die Schuhe vor der Wohnungstür ausziehen? Dass Japaner, wenn sie übermüdet sind, aus Höflichkeit lieber in der Öffentlichkeit schlafen, als ein Treffen mit Freunden abzusagen? Dass in einem japanischen Schwimmbad alle dreißig bis fünfzig Minuten zur gemeinschaftlichen Ruhepause per Lautsprecher aufgerufen wird – und dass ALLE das Becken verlassen und sich daran halten? Sie sind schon anders, die Japaner, und sie können über sich lachen. Eine japanische Fernsehsendung mit dem Namen „Die spinnen, die Japaner“, in der sich in Japan lebende Ausländer über die japanischen Eigenheiten lustig machen, erfreut sich – bei den Japanern – größter Beliebtheit.
Erdteil: Ostasien Landesfläche: 377.801 Km2 Hauptstadt: Tokyo Größte Städte: Tokyo, Yokohama, Osaka Höchster Berg: Fudschijama (3776 m) Währung: 1 Yenn =100 sen Bevölkerung: 126 510 000 Staatsführung: Kaiser (repräsentativ) Regierungsführung: Premierminister Politisches System: Parlamentarische Monarchie Zeitzone: MEZ+8,0 Stunden
19
Was ist der Buddhismus? Wo bestehen die Unterschiede zum Christentum?
Beide Religionen – Christentum und Buddhismus – wollen den Menschen einen Weg aufzeigen, wie er sich aus den Unzulänglichkeiten des Daseins befreien kann. Im Christentum führt dieser Weg über Gott, im Buddhismus führt dieser Weg über den Menschen selbst, der sein Heil ohne Beistand von außen allein realisieren muss. Im Christentum (auch im Judentum und im Islam) findet der Mensch in der Hinwendung zu Gott die Erleuchtung. Im Buddhismus muss sich der Mensch selbst von allen Bindungen loslösen, um Befreiung zu erfahren.
Wer war Buddha? Was bedeutet er für den Buddhisten?
Zunächst: Buddhisten beten nicht zu Buddha und „glauben“ nicht an Buddha in dem Sinne, wie Christen an Gott glauben. In der Philosophie des Buddhismus hat der „Glaube“ allenfalls die
Das einzig Beständige ist der stetige Wandel Zenbuddhismus, Schintoismus, Christentum – in Japan gibt es alle drei Glaubensrichtungen. Japaner sind häufig sogar Buddhisten und Schintoisten gleichzeitig. Der Buddhismus hat sich in Japan zum Zenbuddhismus, einer sehr alltagsverbundenen Richtung des Buddhismus entwickelt, in der dem Handeln und der Meditation eine sehr große Rolle zukommt.
D
er Buddhismus ist mit seinen vielen unterschiedlichen Schulen und Lehren eine der größten asiatischen Religionen – und auch bei uns in der westlichen Welt wird er immer beliebter. Doch ist der Buddhismus eine Religion? Die meisten Menschen würden sagen, dass Religion etwas mit dem Glauben an Gott zu
20
tun hat. So gesehen, ist der Buddhismus keine Religion, denn er kennt keinen Gott. Doch was ist er dann? Eine Weltanschauung oder eine Lebensform? Nach westlichen Maßstäben ist dies schwer zu beurteilen. Was immer er ist, der Buddhismus liegt im Trend. Bekannte Persönlichkeiten, Stars und Sportler beken-
nen sich öffentlich zu dem östlichen Glauben. Ist das nur eine Mode im allgemeinen EsoterikTrend? Die MEDICOM hat sich auf die Suche nach den Grundzügen des östlichen Glaubens gemacht.
Bedeutung von Vertrauen in den von Buddha gewiesenen Weg. Der Dalai Lama ist übrigens auch kein buddhistischer „Papst“, sondern der weltliche Herrscher Tibets und Oberhaupt einer bestimmten Richtung des Buddhismus. Die wichtigste Persönlichkeit des Buddhismus ist Buddha. Buddha, der Erleuchtete, ist die Bezeichnung für einen Menschen, der die Erleuchtung erreicht hat. Der historische Buddha war der Fürstensohn Siddharta Gautama, der etwa 500 vor Christus in Nordindien lebte. Nachdem Siddharta außerhalb seines behüteten Lebens mit den Tatsachen des menschlichen Daseins, wie Alter, Krankheit und Tod konfrontiert wurde, lässt er sein sicheres Leben hinter sich, lebt als Asket und versucht herauszufinden, warum die Menschen leiden müssen. Nachdem er sich fast zu Tode gehungert hat, ohne eine Antwort bekommen zu haben, beginnt er wieder zu essen. Er setzt sich unter einen Baum und beschließt, erst dann wieder aufzustehen, wenn er eine Antwort auf seine Frage hat. Schließlich erlangt er die Erleuchtung und zieht mit einer wachsenden Schar von Jüngern durch das Land.
Buddha verglich seine Lehre mit einem Floß, das man zurücklässt, wenn man das andere Ufer, das Ufer des Erwachens, erreicht hat. Er lehrt die „Vier edlen Wahrheiten“. 1. Alles ist Leiden. (Weil alles vergänglich ist, auch und gerade das Glück.) 2. Ursache dafür sind die drei Grundübel Gier, Hass und Verblendung. 3. Wenn man diese überwindet, endet das Leiden. 4. Der Weg der Überwindung des Leidens ist der heilige achtfache Pfad. Rechte Einsicht Rechter Entschluss Rechte Rede Rechtes Handeln Rechte Lebensführung Rechte Bemühung Rechte Achtsamkeit Rechte Sammlung oder Konzentration
Der historische Buddha bezeichnete Buddhisten glauben an die WieWas ist das sich selbst nur als Religionsstifter, dergeburt. Nach der buddhistiNirvana? er wollte nicht als Gott verehrt werschen Lehre reist ein Wesen von den. Buddha ist nur ein Lehrer, der Leben zu Leben. Viele gute Taten den Menschen Rat auf ihrem Weg in einem Leben führen zu einer zum Nirvana geben kann. Auf diesem Aufhäufung guten „Karmas“, was gute Weg ist der Mensch jedoch auf sich selbst Auswirkungen auf das nächste Leben hat. gestellt, er muss selbst erkennen und erAuf schlechte und grausame Taten folgt fahren. Durch immer mehr Wissen gelangt eine Wiedergeburt im Geisterreich, Tierer immer näher zum Nirvana. reich oder in den Höllenwelten. Nirgends jedoch macht ein Wesen endgültig halt – die Reise geht so lange weiter, bis das Nirvana erreicht ist. Nirvana bedeutet wörtlich „auslöschen“. Es steht für das Ende der Kette der Wiedergeburten. Hier hört alles Wollen und Streben und alle Bewegung auf, da es nichts mehr gibt, wonach man sich sehnen könnte. Die vier Verhaltensweisen, die ins Nirvana führen, sind Güte, Mitleid, mitfühlende Freude und Gleichmut. Im Buddhismus geht es um die Einsicht in die Zusammenhänge Worum des Lebens als eines Zustands geht es im dauernden Wandels und um die Bud-dhisErkenntnis, dass das Bestreben nach Sein und Haben, die Leidenschaften, die Sehnsüchte und Vorstellungen, das Streben nach persönlicher Erfüllung im Vergänglichen, nach Ansehen, Ruhm, Macht und dergleichen niemals völlig befriedigt werden können. Das Begehren schlägt in Hass gegen die verhinderte Wunscherfüllung um, so dass sich Die ethischen Prinzipien des Gier und Hass gegenseitig bedingen. Gier Buddhismus und Hass sind demnach Ausdruck einer Ich-Sucht und der fehlenden Einsicht in Streben nach eigener Einsicht und die Gesetzmäßigkeiten des Lebens. Sie Erkenntnis sind die Ursache für die unheilvollen ZuKein gierhaftes Verlangen und kein stände, die die Welt charakterisieren und Festhalten an materiellen Werten die Bedingungen schaffen, die der BudNeid, Eifersucht und Missgunst dhismus mit dem „Leiden“ meint. entsagen und sich am Wohl ande-
Die Zeit als Rad
rer erfreuen Nicht stehlen Nicht lügen Sich eines unmoralischen Lebenswandels enthalten Kein Lebewesen schädigen oder töten Allen Lebewesen (auch Pflanzen) Wohlwollen entgegenbringen Lieben, ohne Besitz zu ergreifen Ehrliches und rücksichtsvolles Handeln sich selbst und anderen gegenüber Rauschmitteln entsagen Gutes tun, ohne etwas dafür zu wollen
Der Buddhismus vergleicht die Zeit mit einem Rad, das sich dreht und stets an seinen Ausgangspunkt zurückkehrt. Wie die Natur im Wechsel der Jahreszeiten stirbt und wieder erblüht, so ist auch der Wechsel der Generationen geprägt von Geburt, Sterben und Wiedergeburt. Da nichts in der Welt von Bestand ist, muss ein Buddhist lernen, die Dinge hinzunehmen, die gegeben sind. Er kann mit seinen guten Taten jedoch Einfluss nehmen und schließlich ins Nirvana gelangen. Im Buddhismus geht es um die Erkenntnis, dass man nicht der eigene Körper ist, sondern dass man diesen hat, um ihn zu nutzen. Alles was man selbst erlebt, entsteht aus dem eigenen Bewusstsein heraus. Nach dem Tod verlässt dieses Bewusstsein den Körper, um sich später wieder mit einem neuen Körper zu verbinden.
FOTOS AUF DEN SEITEN 20 UND 21: DIGITALVISION
21
Länger gesund mit „pflanzlichen Hormonen“ Die Sojapflanze war in Asien schon vor mehr als 4.000 Jahren bekannt und galt als heilig. Soja wurde nicht nur als wertvolles Nahrungsmittel, sondern auch als Heilpflanze geschätzt. Auch hierzulande sind Sojaprodukte mittlerweile als nährstoffreiche und gesunde Lebensmittel anerkannt.
D
em eigentlichen Geheimnis der Sojabohne – obwohl im asiatischen Kulturkreis schon lange bekannt – kam die westliche Welt jedoch erst vor einigen Jahren auf die Spur: der wohltuenden Wirkung der Phyto-Östrogene. Bei den Phyto-Östrogenen handelt es sich um Pflanzenstoffe, die ihrer Struktur nach den vom Menschen selbst gebildeten Östrogenen ähneln, allen voran dem weiblichen Sexualhormon. Infolge dieser Ähnlichkeit mit den Östrogenen können Phyto-Östrogene an dieselben Rezeptoren binden wie ihre humanen Strukturverwandten und somit auch östrogenähnliche Wirkungen im
FOTO: PHOTODISC
Japanerinnen kennen keine Wechseljahresbeschwerden. Es gibt nicht einmal ein Wort dafür.
22
menschlichen Stoffwechsel erzeugen. Die wichtigsten Phyto-Östrogene sind die so genannten Isoflavone aus Soja. Aber auch in vielen Getreidesorten und Pflanzensamen kommen PhytoÖstrogene vor; diese werden als Lignane bezeichnet. Leinsamen enthält besonders viele Phyto-Östrogene; geringere Mengen Lignane finden sich außerdem in Kürbiskernen sowie in Weizenkleie, Roggen und Buchweizen. Das medizinische Phänomen, dass Japanerinnen keine Wechseljahresbeschwerden kennen, wird auf ihren hohen Soja-Konsum zurückgeführt. Mit den vielen verschiedenen Sojaprodukten, die in der japanischen Küche gebräuchlich sind, verzehren die Japanerinnen täglich wesentlich höhere
Frauen in den Wechseljahren haben infolge der nachlassenden Wirkung ihrer Östrogene zumeist auch ein erhöhtes Osteoporose-Risiko. Hier sind die PhytoÖstrogene ebenfalls hilfreich: Sie können nicht nur dem osteoporosebedingten Knochenabbau entgegenwirken, sondern sogar die Knochenmineraldichte erhöhen, z. B. im Oberschenkelhals. Phyto-Östrogene beeinflussen auch bestimmte Parameter des Knochenstoffwechsels positiv wie z. B. den Serumspiegel des Knochenproteins Osteocalcin. Damit nicht genug, sind Phyto-Östrogene auch antioxidativ wirksam und somit in der Lage, aggressive freie Radikale unschädlich zu machen. So können Isoflavone beispielsweise das LDL-Cholesterin im Blut vor Oxidation bewahren, also vor dem Angriff durch Sauerstoffradikale. Erst durch die Oxidation wird das LDL-Cholesterin tatsächlich zum potenziellen Risikofaktor für Arteriosklerose. Da die Phyto-Östrogene außerdem auch die Elastizität der Arterien verbessern,
wirken sie sich somit positiv hinsichtlich der Gesundheit von Herz und Kreislauf aus. Wie Untersuchungen zeigen, können Isoflavone als Antioxidanzien auch das sensible Erbmaterial der Zellen, die DNA, schützen und außerdem die Aktivität antioxidativer Enzymsysteme im Körper verstärken. Soja und Leinsamen stehen nach unseren Ernährungsgewohnheiten eher selten auf dem Speiseplan. Angesichts der zahlreichen positiven Effekte der PhytoÖstrogene empfiehlt es sich daher für Frauen in den Wechseljahren, sich zusätzlich über geeignete phytoöstrogenreiche Nahrungsergänzungen mit diesen wichtigen Substanzen zu versorgen.
Soja ist eine Hülsenfrucht und wächst in nur 100 Tagen an der einjährigen strauchigen Sojapflanze.
Was iert in den Wechseljahren?
N
ichts läuft ohne sie, die Hormone. Die winzigen Signalstoffe steuern die Funktion jeder Körperzelle und jedes Organs. Sie beeinflussen unser Wachstum, unseren Schlaf, unsere Verdauung, unsere Fortpflanzung und unsere Gefühle. Das weibliche Sexualhormon Östrogen hat zum Beispiel 400 vitale Wirkungen auf die Körperzellen. Doch in den Wechseljahren lässt die körpereigene Produktion von Östrogen nach. Das kann ab dem 40. Lebensjahr allmählich zu einem Mangelzustand führen. Jede Frau empfindet die körperlichen und seelischen Veränderungen auf unterschiedliche Weise. Es kommt oft zu Hitzewallungen, Schweißausbrüchen, Schlafstörungen und anderen Symptomen der hormonellen Veränderung. Viele fühlen sich auch oft reizbar oder erschöpft. Ungefähr 70 Prozent der deutschen Frauen leiden unter diesen typischen Wechseljahresbeschwerden. Früher waren Hormonersatz-Therapien mit Östrogen das Mittel der Wahl gegen diese Beschwerden. Heute nehmen immer mehr Frauen davon Abstand, denn eine wachsende Zahl von neuen Studien macht auf die Gefahren der HormonersatzTherapie aufmerksam (mehr dazu auf Seite 24). Phyto-Östrogene, die in Soja enthalten sind, stellen eine gute Alternative dar. Denn das Phyto-Östrogen kann sich wie das Human-Östrogen mit dem Zellkern verbinden. Ist die Östrogenkonzentration im Körper zu gering, dann können die Phyto-Östrogene an die nun freien Bindungsstellen des Zellkerns „andocken“. FOTO: CREATAS/PICTUREQUEST
Mengen an Phyto-Östrogenen als Frauen in den westlichen Industrieländern. Der Effekt: Die Isoflavone des Soja kompensieren dabei quasi die in den Wechseljahren nachlassende Produktion und Wirkung der körpereigenen Östrogene, und die typischen Beschwerden der Wechseljahre, wie z. B. Hitzewallungen oder Schweißausbrüche, treten weniger oder gar nicht auf. Studien mit Frauen in den Wechseljahren zeigten ebenfalls, dass Isoflavone aus Soja die Häufigkeit der Hitzewallungen reduzieren können.
23
Erhöhtes Brustkrebsrisiko durch Hormontherapie Die Gefahren einer Hormontherapie gegen Wechseljahresbeschwerden sprechen ebenfalls dafür, diese mit natürlichen Mitteln zu bekämpfen. Frauen, die in den Wechseljahren Hormone einnehmen, haben, einer neuen Studie zufolge, ein deutlich höheres Risiko, an Brustkrebs zu erkranken. Das gilt vor allem für die Kombinationsbehandlung mit den Hormonen Östrogen und Progestagen. Das besagt eine englische Studie, die vor kurzem in der renommierten Fachzeitschrift „The Lancet“ veröffentlicht wurde.
B
ei der bisher größten Untersuchung zum Thema Hormonersatztherapie wurden von 1996 bis 2001 mehr als eine Million Frauen zwischen 50 und 64 Jahren befragt. Dabei wurden die Art, die Länge und die Dosierung der Hormontherapie betrachtet. Über einen Zeitraum von zweieinhalb Jahren zeigte sich, dass Frauen, die eine Hormontherapie durchführten, im Vergleich zu Frauen, die niemals Hormonersatzpräparate verwendet hatten, ein um 66 % erhöhtes Brustkrebsrisiko sowie ein um 22 % erhöhtes Sterberisiko aufwiesen. Die Studie ergab außerdem, dass jede Art der Hormontherapie, wenn auch in unterschiedlichem Ausmaß, das Risiko erhöhte und dass das Risiko nach dem Absetzen der Präparate wieder sank. Bei der Beurteilung des gesamten Krankheitsrisikos schnitt die Östrogen/Progestagen-Kombinationstherapie bei weitem am schlechtesten ab (Krankheitsrisiko um 100 Prozent erhöht). Tibolon (Kombination aus Androgen, Östrogen, Gestagen) führte immer noch zu einem um 45 % erhöhten Gesamt-Krankheitsrisiko.
In Zukunft müssen Frauen in den Beipackzetteln wesentlich deutlicher auf gesundheitliche Risiken bei der Einnahme von Hormonpräparaten gegen Wechseljahresbeschwerden hingewiesen werden. Eine neue Studie macht erneut große Risiken deutlich. 1.156
Verordnung von Östrogenen
Im Vergleich dazu führte eine reine Östrogentherapie, wie sie bei Frauen ohne Gebärmutter eingesetzt wird, „nur“
1.037
in Millionen Tagesdosen
GARFIK: DPNY
884
FOTO: THINKSTOCK
QUELLE: ARZNEIVERORDNUNGSREPORT 2002
24
zu einem um 30 Prozent erhöhten Gesamt-Krankheitsrisiko. Grundsätzlich gilt: Je länger eine Hormontherapie durchgeführt wird, desto größer wird das Risiko, an Brustkrebs zu erkranken – unabhängig von der Dosierung und der Art des Östrogens oder Progestagens und auch unabhängig davon, ob die Hormonpräparate in Form von Tabletten, Pflastern oder Implantaten gegeben werden. Ab dem 1. November dieses Jahres müssen Hersteller von Hormonpräparaten gegen Wechseljahresbeschwerden in ihren Produktinformationen deutlich auf das Risiko von Brustkrebs, Herzinfarkten und Schlaganfällen hinweisen. Das berichtet das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) in Bonn. Dem Ergebnis dieser Studie folgend empfiehlt die Österreichische Krebshilfe Frauen, die sich einer Hormontherapie gegen Wechseljahresbeschwerden unterziehen, diese wenn möglich in Absprache mit dem Arzt zu beenden und auf Behandlungsalternativen zurückzugreifen. Die pflanzlichen Phyto-Östrogene aus Soja sind eine gute und wirksame Alternative zu den künstlichen Hormonen. Phyto-Östrogene unterstützen den Hormonhaushalt während der Wechseljahre und gleichen die fehlende Menge körpereigener Östrogene sanft aus.
HIER AUSSCHNEIDEN
VITALSTOFF lexikon
Gamma-Linolensäure Macht die Haut zart und weich
FOT O: D PNY
ie pflanzliche Gamma-Linolensäure gehört zu den Fettsäuren, die für den menschlichen Organismus am wichtigsten sind. Sie zählt zu der Gruppe der Omega-6-Fettsäuren. Diese sind unentbehrlich für die Steuerung vieler Körper- und Stoffwechselfunktionen.
D
Enthalten z. B. in
Gesunde Haut ist glatt und elastisch. Sie übersteht den „Zupftest“ ohne Spuren. Spröde, trockene und rissige Haut hingegen bleibt beim Zupftest stehen. Dies kann auf einen Mangel an GammaLinolensäure hinweisen.
Muttermilch, Borretsch-Öl
Herkunft - Funktion - Versorgung Gamma-Linolensäure hilft der Haut, ihre natürliche Barrierefunktion zu erfüllen. Besonders reich an Gamma-Linolensäure ist Borretsch-Öl, das somit die Gesundheit der Haut unterstützen kann. GammaLinolensäure ist ein Strukturbestandteil der Haut; sie ist beteiligt an der Regulation des Zellwachstums und spielt eine große Rolle bei der Zellerneuerung. Auch Muttermilch enthält viel GammaLinolensäure, denn sie ist maßgeblich an der Entwicklung des Neugeborenen beteiligt. Wissenschaftler glauben, dass bei Neurodermitikern und Psoriasis-Betroffenen die körpereigene Produktion von GammaLinolensäure gestört ist und sich deshalb die typischen Mangelerscheinungen zeigen: trockene, rissige Haut, Rötungen und Juckreiz. Gamma-Linolensäure ist in nennenswerter Menge (außer in Muttermilch) nur in wenigen Lebensmitteln enthalten. Es empfiehlt sich, bei Verdacht auf Mangelerscheinungen dem Körper mit Hilfe einer Nahrungsergänzung eine Extra-
FOTO: DPNY
ration Gamma-Linolensäure zuzuführen. Nahrungsergänzungen enthalten pflanzliche Öle mit unterschiedlichem Gehalt an Gamma-Linolensäure. Besonders reich an Gamma-Linolensäure ist das aus dem Samen der Borretschpflanze gewonnene Öl.
Verwendung von Gamma-Linolensäure Psoriasis/Neurodermitis: Gamma-Linolensäure kann Hautreaktionen abschwächen, den Juckreiz mildern und die Empfindlichkeit der Haut bei Kindern und Erwachsenen positiv beeinflussen. Ekzeme: Gamma-Linolensäure kann das Hautbild verbessern und den Juckreiz beseitigen.
Brauchen Sie Gamma-Linolensäure?
JA
Leiden Sie an einer Hauterkrankung wie Neurodermitis oder Psoriasis (Schuppenflechte)? Oder haben Sie andere Hautprobleme? (z. B. trockene Haut)
MEDICOM Sonderheft zum Ausschneiden und Sammeln
Wie viel Gamma-Linolensäure braucht der Körper? Empfehlung Unabhängige Ernährungswissenschaftler empfehlen eine tägliche Zufuhr von 440 mg Gamma-
MEDICOM 27. Ausgabe, Dezember 2003
FOTO: PHOTODISC
Schon bei einem angekreuzten „Ja-Feld“ könnte eine ergänzende Zufuhr von Gamma-Linolensäure hilfreich sein.
25
VITALSTOFF lexikon
FOTO: PHOTODISC
Omega-3-Fettsäuren Kraftstoff für Herz und Gehirn apaner und Eskimos sind wegen ihres reichlichen Fischverzehrs gesünder als die Mitteleuropäer. Daran haben insbesondere die Omega-3-Fettsäuren einen großen Anteil, denn Fisch ist sehr reich an Omega-3-Fettsäuren, die für viele Stoffwechselvorgänge bedeutend sind. Die besonders hochwertigen Fischöl-Fettsäuren EPA und DHA kann der menschliche Körper nur in geringem Umfang aus der pflanzlichen Alpha-Linolensäure selbst bilden. Eine Ergänzung der Ernährung mit Omega-3-Fettsäuren ist deshalb sehr sinnvoll.
J
Heringen, Thunfisch, Lachs, Makrelen, Heilbutt, Bachforellen, Hummer, Garnelen, Hecht und Miesmuscheln
Herkunft - Funktion - Versorgung Die wichtigsten Omega-3-Fettsäuren sind die Alpha-Linolensäure, die Eicosapentaensäure (EPA) und die Docosahexaensäure (DHA). Sie werden im Körper für den Aufbau und die Erhaltung der Zellwände gebraucht. In unseren Breiten führt man sich infolge geringen Fischverzehrs meist zu wenig Omega-3Fettsäuren zu. Eine unausgewogene Ernährung, Diäten oder Verdauungsstörungen können ebenfalls zu einer schlechten Versorgung mit Omega-3-
FOTO: DPNY
Wie viel Omega-3-Fettsäuren braucht der Körper? Empfehlung Unabhängige Ernährungswissenschaftler empfehlen eine tägliche Zufuhr von 700 mg bis 1.000 mg
Fettsäuren beitragen. In der Zeit des Wachstums in Kindheit und Jugend sowie in der Schwangerschaft ist der Bedarf an Omega-3-Fettsäuren aufgrund des raschen Zellwachstums erhöht. Über die Ernährung ist eine hohe Omega-3Fettsäurenzufuhr schwer zu erreichen. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung gibt an, dass Omega-3-Fettsäuren etwa 0,5 % der Energiezufuhr ausmachen sollten. Das entspricht bei einer Energiezufuhr von 2.000 Kilokalorien am Tag etwa einem Gramm Omega-3Fettsäuren. Britische Gremien empfehlen sogar eine tägliche Zufuhr von 1,2 g. Dies ließe sich nur durch eine massive Erhöhung des Fischkonsums erreichen. Mindestens dreimal wöchentlich müsste dann Fisch auf Ihrem Speiseplan stehen.
Vorbeugung gegen Arteriosklerose: Omega-3-Fettsäuren unterstützen die natürlichen Fließeigenschaften des Blutes und können eine cholesterinbewusste Ernährung unterstützen. Rheuma (Gelenkerkrankungen): Omega3-Fettsäuren können in hoher Dosis zur Gesundheit der Gelenke beitragen, indem sie überschießende Entzündungsreaktionen mildern. Die bei rheumatischen Krankheiten auftretenden Schmerzen, Entzündungen und Gelenkversteifungen können vermindert werden. Hoher Blutdruck: In sehr hoher Dosierung haben Omega-3-Fettsäuren eine blutdrucksenkende Wirkung. Depressionen: Eine Milderung von Depressionen durch Omega-3Fettsäuren wurde zwar schon beobachtet, gilt aber noch als umstritten.
Brauchen Sie Omega-3-Fettsäuren? Schon bei einem angekreuzten „Ja-Feld“ könnte eine höhere Aufnahme von Omega-3-Fettsäuren für Sie sinnvoll sein.
JA
Haben Sie ein erhöhtes Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen (z. B. familiäre Veranlagung, Rauchen)?
FOTO: PHOTODISC
Enthalten z. B. in
Verwendung von Omega-3-Fettsäuren
Essen Sie selten Fisch, insbesondere fettreichen Meeresfisch? Leiden Sie unter entzündlichen Erkrankungen des Bewegungsapparates (z. B. Rheuma, Polyarthritis)?
MEDICOM Sonderheft zum Ausschneiden und Sammeln
und das lange Leben in Japan
J
apaner essen etwa fünfmal so viel Fisch wie Deutsche und zählen weltweit zu den größten Fischfangnationen. Den Fisch kann man frisch, geräuchert, gegrillt oder getrocknet kaufen. Meistens wird er aber frisch verkauft. Fische enthalten die wertvollen Omega3-Fettsäuren, die zu den essenziellen, mehrfach ungesättigten Fettsäuren gehören, die der Mensch mit der Nahrung aufnehmen muss. Eine Vielzahl medizinischer und ernährungswissenschaftlicher Studien deutet darauf hin, dass Omega3-Fettsäuren eine positive Wirkung auf die Fließeigenschaft des Blutes haben. Das Blut wird flüssiger und kann somit auch in feinen Blutgefäßen besser fließen. Doch mit dem Genuss von viel Fisch geben die Japaner sich nicht zufrieden. Omega-3Fettsäuren in Form von Nahrungsergänzungsmitteln gehören in Japan zu den
neuesten und erfolgreichsten Mitteln auf dem Markt der Mikronährstoffe. Denn sie verhelfen nicht nur dazu, sehr lange sehr gesund zu bleiben – sie halten auch geistig fit. Da die Omega-3-Fettsäuren Bestandteile der Zellmembranen aller Körperzellen sind, spielen sie auch bei der Erhaltung der Gehirn- und Nervenzellen eine fundamental wichtige Rolle.
Gründen auch noch andere Ursachen dafür: In unseren Breiten bekommt man nicht überall frischen Fisch und er gehört zu den teuersten Nahrungsmitteln. Und: Nicht jeder mag Fisch. Wer aber nicht genügend Fisch zu sich nimmt, sollte zu Nahrungsergänzungen greifen, die Omega-3-Fettsäuren enthalten.
Es gibt Untersuchungen, die belegen, dass Omega-3-Fettsäuren in hoher Dosierung vor neurologischen Erkrankungen schützen, und, wenn diese bereits aufgetreten sind, sie sogar lindern können. So verhilft das Fischöl Japanern zu einem langen, gesunden Leben, und es sorgt gleichzeitig dafür, dass sie es auch bei bester geistiger Gesundheit genießen können. Leider ist der Verzehr von Fisch in den westlichen Industrienationen wenig verbreitet. Es gibt außer kulturellen
In Japan übersteigt die Zahl der Hundertjährigen erstmals die Marke 20.000. Laut dem japanischen Gesundheitsministerium dürften Ende September 20.561 Menschen im Alter von 100 Jahren oder älter in Japan leben. Die Zahl der Hundertjährigen stieg zum Vorjahr um 2627 und verdoppelte sich im Vergleich zum Jahr 1998. FOTO: TONY STONE
Japan ist die einzige Industrienation, in der die Menschen große Mengen an Omega3-Fettsäuren in Form von Fisch zu sich nehmen. Das ist der Grund dafür, dass die Herzinfarktrate dort sehr niedrig liegt. In jüngster Zeit steigt sie jedoch parallel mit dem Vordringen westlicher Ernährungsgewohnheiten an. Ein deutlicher Beweis für den Zusammenhang zwischen Herzgesundheit und der Einnahme von Omega3-Fettsäuren.
27
„Wir sollten den traditionellen Fischtag in Deutschland wieder aufleben lassen“, kommentierte der Internist und Privatdozent Dr. Peter Singer die Ergebnisse der von ihm durchgeführten Studie. Das wird aber nicht genügen, denn um 3 Gramm Omega-3-Fettsäuren am Tag zu sich zu nehmen, müssen Sie sehr viel Fisch essen. Schon das von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung empfohlene eine Gramm pro Tag (für Gesunde) zu erreichen ist nicht einfach. Bei den in Deutschland beliebtesten Fischarten Rotbarsch, Heilbutt und Forelle wären dazu 750 g pro Woche nötig – da muss man Fisch schon richtig mögen. Daher sollten Menschen mit Herzproblemen alternativ oder zusätzlich Fischöl-Kapseln mit Omega-3-Fettsäuren einnehmen, empfiehlt Singer.
Lange gesund dank Fischöl. Omega-3-Fettsäuren sind im Fisch enthalten. Sie schützen vor Herz- und Lungenerkrankungen. Doch mit hin und wieder mal etwas Fisch essen ist es nicht getan.
Neue Erkenntnisse zu Fischöl Neue Forschungsergebnisse belegen die positive Wirkung von Omega-3-Fettsäuren bei Herz-Kreislauferkrankungen und gegen Lungenversagen Neue Studie belegt: Schutz vor Reinfarkten und plötzlichem Herztod Seit langer Zeit sind in Fachkreisen die günstigen Wirkungen von Omega-3Fettsäuren (Fischöl) auf Herzerkrankungen bekannt. So sollen sie unter anderem die Wahrscheinlichkeit für Reinfarkte nach bereits erfolgten Infarkten um bis zu 30 % reduzieren können. Bislang lagen aber kaum Studien vor, die einen konkreten Nachweis dafür erbringen konnten. Wie die Fachzeitschrift „Die Medizinische Welt“ kürzlich berichtete, führt eine neue deutsche Studie, die die Wirksamkeit von Omega-3-Fettsäuren auf Herzrhythmusstörungen untersucht hat, jetzt den Beweis an. In der randomisierten und placebokontollierten Studie wurden 51 Patienten mit Herzrhythmusstörungen,
FOTO: DPNY
28
aber ohne koronare Herzkrankheit (durch verengte Herzkranzgefäße verursachte Mangeldurchblutung des Herzmuskels) und Herzinsuffizienz (Herzmuskelschwäche) in zwei Untergruppen unterteilt. Eine Gruppe erhielt über 6 Monate zu der ansonsten unveränderten Kost am Tag 3 Gramm Omega-3-Fettsäuren in Form von Fischölkapseln, die andere Gruppe erhielt ein Placebo. Bei der Gruppe, die das Fischöl einnahm, senkten sich der Triglyzerid- sowie der Fibrinogen-Spiegel, der Blutdruck sank und die Thrombozytenaggregation wurde reduziert. Damit wird Thrombosen und Blutgerinnseln vorgebeugt. Die Omega3-Fettsäuren senkten den Spiegel des „schlechten“ LDL-Cholesterins, während sie gleichzeitig den „guten“ HDL-Cholesterinwert hoben. Sechs Wochen nach Absetzen der Fischölkapseln wurden die alten Werte wieder erreicht. Bei der Gruppe, die ein Placebo nahm, gab es keinerlei Veränderungen.
Eine Studie an 82 Kliniken in Deutschland hat die lebensrettenden Eigenschaften von Fischöl bewiesen. In einer über mehrere Jahre andauernden Untersuchung des Dresdner Universitätsklinikums ergänzten die Wissenschaftler die Ernährung von Patienten auf den Intensivstationen mit Fischöl. In der Folge kam es weniger oft zu Lungenversagen, einer häufigen Todesursache bei Patienten auf Intensivstationen. Die Patienten litten unter weniger Infektionen und benötigten geringere Mengen an Antibiotika. Omega-3-Fettsäuren waren auch in diesem Fall die wichtigsten Bestandteile des Öls und damit Auslöser der lebensrettenden Wirkung. Die Dresdner Forscher präsentierten ihre Ergebnisse auf dem Kongress der Deutschen Gesellschaft für Anästhesiologie und Intensivtherapie in München.
FOTO: MARKUS JASER, WWW.JAPAN-FOTOGALERIE.DE
FOTO: PHOTOS.COM
Fischöl kann Leben retten
Besonders viele gesunde Fettsäuren sind in Fischen wie Lachs oder Thunfisch enthalten. Am besten eignet sich dabei frischer oder gefrorener Fisch.
Meditation in Bewegung
D
er Anblick der harmonischen Bewegungen übt auf den Betrachter eine gewisse Faszination aus. Es war im 13. Jahrhundert, als ein chinesischer Mönch einen Kampf zwischen einer Schlange und einem Kranich beobachtete. Der Mönch – mit Namen Cheng San Feng – bemerkte, dass der Vogel trotz seines spitzen Schnabels die Schlange nicht besiegen konnte, weil sie ihm immer wieder geschickt auswich. Das brachte den Mönch zu der Erkenntnis, dass die Schlange durch ihre geschmeidigen Ausweichbewegungen dem aggressiven Hacken des Vogels überlegen ist und dass das Weiche letztlich das Harte besiegt. Er entwickelte eine Bewegungs- und Selbst-
Tai
Chi
Chuan
verteidigungskunst, die auf dieser Erkenntnis beruht, und nannte sie Tai Chi Chuan. Tai Chi Chuan kommt eigentlich aus China, ist aber auch in Japan weit verbreitet. Zunächst in Klöstern zur Selbstverteidigung der Mönche geübt, wurde es später als Familiengeheimnis von Generation zu Generation weitergegeben. Bei dieser leicht zu erlernenden Bewegungskunst werden weiche, runde, langsam ausgeführte Bewegungen durch fließende Übergänge zu einer kontinuierlichen Bewegungsfolge, der Tai-Chi(Chuan) Form. Diese vereint Anteile von Heilgymnastik, Meditation, Bewegungskunst und Selbstverteidigung. Im Laufe der Zeit entstanden verschiedene Stile,
Bei der T-StepPosition ruht das ganze Gewicht auf einem Fuß, während der andere angezogen ist. Der angezogene Fuß wird sich gleich zu einem Schritt oder zu einem Tritt bewegen.
FOTOS AUF DER SEITE 29: TIBIA PRESS - FLOWMOTION-BUCH TAI CHI 2003
Vielleicht ist Ihnen bei einem Spaziergang im Park schon einmal eine Gruppe von Menschen aufgefallen, die mit langsamen, geschmeidigen Bewegungen in Zeitlupe zu tanzen schien. Bei diesem Tanz – der eigentlich eine Kampfkunst ist – handelte es sich sicher um Tai Chi Chuan.
29
Der Bogenschritt. Die Füße stehen so weit auseinander, als würde der Schüler auf einem Eisenbahngleis laufen, wobei ein Fuß auf jeder Schiene steht.
Die Tai-Chi-Chuan Form ist eine kontinuierliche Bewegungsabfolge.
30 30
Bei uns ist Tai Chi Chuan auch als „Schattenboxen“ bekannt, da meist allein gegen einen unsichtbaren Gegner „gekämpft“ wird. Der Begriff „kämpfen“ führt dabei etwas in die Irre. Zwar handelte es sich bei Tai Chi ursprünglich um eine Kampfkunst, doch sind die Bewegungen bei der heute praktizierten Form nicht schnell und hart, wie wir sie uns bei einem Kampf vorstellen, sondern weich und fließend. Auch handelt es sich beim modernen Tai Chi nicht um einen Kampf gegen einen äußeren Gegner, sondern man kämpft für die eigene Ausgeglichenheit. Die Mühelosigkeit der Bewegungen entsteht dadurch, dass Körper und Geist als Gesamtheit agieren. Tai Chi Chuan wird übersetzt als „Faust(kampf), der auf dem höchsten Pol bzw. Prinzip beruht“. Dabei steht der „höchste Pol“ für die höchste schöpferische Kraft, die Polarität von Yin und Yang. Wie auch in der Heilkunde oder in der Ernährungsphilosophie östlicher Kulturen geht es beim Tai Chi Chuan um das Fließen des Chi (japanisch Ki), den Fluss der Lebensenergie. Tai Chi stärkt Sehnen, Bänder und die Muskulatur, was dazu führt, dass Verspannungen sich lösen und die Lebensenergie ungehindert fließen kann. Durch die Entspannung wird die Atmung tiefer, sodass die Energie in den Unterbauch sinkt, sich dort sammelt und dann an die Orte im Körper gelangt, an denen sie am meisten benötigt wird. Weil in der Entspannung die Atmung
sehr tief ist, werden auch der Blutkreislauf und der Stoffwechsel optimal gefördert. Mit Tai Chi Chuan werden also nicht nur die Beweglichkeit verbessert und Haltungsfehler korrigiert, sondern die gesamte Gesundheit wird positiv beeinflusst. In diesem Prozess erlangt der Schüler eine starke innere Kraft, die sowohl dem Geist als auch dem Körper zugute kommt. In China, Taiwan, Japan und inzwischen auch weltweit wird Tai Chi vor allem zum Zwecke der Prävention von Herzkreislauf-Erkrankungen, Rückenerkrankungen, Gelenkproblemen und Verspannungen eingesetzt.
FOTO: PHOTODISC
die zwischen 24 und 108 Bewegungsfiguren lehren. Als Selbstverteidigungskunst ist Tai Chi Chuan weitestgehend in Vergessenheit geraten, nicht jedoch als Gesundheitslehre.
Yin & Yang, die universelle Energie
Das Yin & Yang-Symbol steht für die andauernde, sich gegenseitig durchdringende und darin ausbalancierte Beziehung zweier polarer Kräfte, also der Vereinigung der Gegensätze. Eine Störung dieses Gleichgewichtes verursacht einen Mangel auf der einen Seite und einen Überschuss auf der anderen Seite. Die Folgen dieses Ungleichgewichtes sind meist gesundheitliche Probleme. Mit Tai Chi Chuan versucht man, die Balance der gegensätzlichen Kräfte zu erreichen und zu erhalten. Die Anwendung des Tai Chi Chuan verkörpert in den Bewegungsabläufen bereits diese Gegensätzlichkeit: die Ruhe in der Bewegung. Es geht darum, Bewusstheit zu erlernen, und alles, was man tut, bewusst zu tun. Das bedeutet, Bewegungen und Aktionen langsam und konzentriert auszuführen und sie voll und ganz wahrzunehmen – sie bewusst zu gestalten. Krankheiten sind gemäß dieser Philosophie die Folge der Vernachlässigung dieser Bewusstheit im Handeln.
Der philosophische Hintergrund Philosophischer Hintergrund für die Wirksamkeit des Tai Chi Chuan ist die asiatische Weltsicht, dass alles einem ständigen Fluss der Veränderungen unterworfen ist, der sich aus der Polarität von Yin (weibliche Kräfte) und Yang (männliche Kräfte) ergibt. Nur im harmonischen Miteinander dieser Kräfte kann die Lebensenergie, das Chi (oder Ki) ungehindert fließen. Durch Bewegungen, die oft von Tierverhalten inspiriert sind, wird dieser Energiefluss stimuliert.
Wenn sich die Hand in keiner besonderen Postion befindet, sollte sie weder starr noch schlaff sein, damit die Energie frei fließen kann. Hier sehen Sie die Position „Die gute Faust“.
Bewegungen, die denen frei lebender Tiere nachempfunden sind. Diese Bewegungen basieren auf einer tiefen ursprünglichen Entspannung von Körper und Geist, denn je mehr man lernt, den Körper zu entspannen, desto entspannter wird auch der Geist – was wiederum positiv auf den Körper zurückwirkt.
Die Praxis Allen Tai-Chi-Chuan Formen gemeinsam ist der Wechsel (Yin & Yang-Prinzip) der Belastung der Beine und das oft gegensätzliche Kreisen der Arme. Die Beine stehen dabei fest auf dem Boden, während der Oberkörper flexibel bleibt. Schon die Namen dieser Übungen machen deutlich, dass der Ausführende ein Geschöpf ist, das zwischen Himmel und Erde lebt. Übungen mit Namen wie „Der weiße Kranich breitet die Flügel aus“ oder „Den Tiger zum Berg zurücktragen“ veranlassen die Schüler dieser Kunst, über die Bedeutung der Formen nachzudenken und sie beim Üben vor dem inneren Auge zu behalten. Die bewusste Umsetzung der inneren Bilder führt so zu den fließenden
B U C H - T I P P
Flowmotion-Tai Chi ist eine neue Form der Darstellung von Bewegung in einem Buch (mittels BildTechnik). Die Anleitungen sind so aufgebaut, dass sie leicht nachvollziehbar sind. Erschienen 2003 im TibiaPress Verlag. 12,80 Euro / ISBN 3-935254-06-7.
Medizinische Studien Tai Chi Chuan mindert Stresssymptome und reduziert das Auftreten von Ängsten, Depressionen, Schwäche und allgemeinen Stimmungsveränderungen. (Journal of Psychosomatic Research 1989 Vol33(2) 197-207)
Tai Chi Chuan minimiert die Auswirkungen von chronischen Krankheiten wie Allergien und Asthma. (American Juornal of Chinese Medicine 1981 Spring Vol.9(1) 15-22)
Tai Chi Chuan verbessert die Atemkapazität. (Hawaii Medical Journal (8) Vol. 5 1992
FOTOS AUF DEN SEITEN 30 UND 31: TIBIA PRESS - FLOWMOTION-BUCH TAI CHI 2003
Die körperlichen Bewegungen des Tai Chi Chuan haben einen geistigen Hintergrund, denn der Körper wird vom Geist gelenkt. Die koordinierten Körperübungen fördern demnach auch das geistige Wachstum. Es geht darum, dass der Körper und die Seele eins werden sollen.
31
Leicht, gesund und lecker Japanische Küche – mehr als Sushi All die Aspekte gesunden Bewusstseins, die zu einem erfüllten und langen Leben der Menschen in Japan beitragen, wären natürlich nicht vollständig
GE MA EI : TH TO FO NK BA
Eines der gesündesten Nahrungsmittel und allgegenwärtig in und auf Japans Tellern und Schüsseln: Fisch und Co
32
aufgezählt, wollten wir den langlebigen Japanern nicht in die Töpfe und auf die schön dekorierten Teller schauen. Von jahrtausende alten Traditionen geprägt, ist die japanische Esskultur eng mit der Kunst und der Philosophie verbunden. Essen ist für die Japaner eine sehr wichtige Angelegenheit. Und selbst wenn es ganz schnell gehen muss, schaffen sie es, dieses Fast-Food gesund zu gestalten. Höchste Ansprüche stellen die Japaner, was die Frische der Zutaten für ihre Mahlzeiten angeht. Nicht zuletzt auch deshalb und weil sie so leicht und gesund ist, erfreut sich die japanische Küche in Deutschland immer größerer Beliebtheit. Die Ästhetik der japanischen Gerichte und des Ambientes, die Verwendung exotischer Zutaten wie Seetang und die ungewohnten Esswerkzeuge sorgen zusätzlich für Faszination. Die meisten Elemente der japanischen Küche
stammen aus China. Dazu zählen zum Beispiel der Gebrauch des Woks, der sich ebenfalls hierzulande zunehmender Beliebtheit erfreut, und die Essstäbchen (jap. Hashi). Neben China zählt Indien zu einem der wichtigsten Ursprungsgebiete der japanischen Küche. Das bekannteste Beispiel ist wohl der Curryreis, der in Japan zu den beliebtesten Speisen zählt. Trotz der Anlehnung an die chinesische und die indische Küche hat die japanische Küche ein eigenes, unverwechselbares Wesen. In der japanischen Küche wird deutlich weniger Fleisch verwendet als in den meisten europäischen Küchen. Dies hat unter anderem auch mit dem Buddhismus zu tun, der eine vegetarische Ernährungsweise empfiehlt. Reis, Fisch, Meeresfrüchte, verschiedene Sorten von Gemüse, Nudeln und Sojaprodukte werden häufig gegessen. Eine besondere Zutat der japanischen Küche ist der Seetang, der in warmen Gewässern gezüchtet wird. Er begleitet als Gemüse aus dem Meer fast jede Speise. Das wichtigste Nahrungsmittel in Japan ist jedoch der Reis. Er wird zu allen Mahlzeiten, zum Frühstück, zum Mittagund zum Abendessen serviert. So wie der Reis ist auch die Sojasauce bei fast jeder Mahlzeit gegenwärtig. Während in den meisten europäischen Ländern ein gutes Mahl aus mehreren Gängen – also der Vorspeise, dem Hauptgericht und der Nachspeise – besteht, spielt eine solche Unterteilung in Japan keine große Rolle. Alle Speisen werden in der Regel gleichzeitig auf den Tisch gestellt, und man kann sich selbst aussuchen, in welcher Reihenfolge man sie essen möchte.
Gesundheit am laufenden Band. In manchen Restaurants fährt die Speise den Gästen „vor der Nase herum“. Sie brau
Warum is(s)t man in Japan gesünder? Aus ernährungswissenschaftlicher Sicht ernähren sich die Japaner weit ausgewogener als die Deutschen. Das ist auch einer der Gründe, warum sie bis ins hohe Alter gesünder bleiben als wir Europäer. Was aber macht die japanische Küche so gesund? Für Sie haben wir die wichtigsten Aspekte zusammengestellt.
liefern dem menschlichen Organismus hochwertiges und besonders leicht verdauliches Eiweiß und eine Vielzahl von Vitaminen und Mineralstoffen. Der Gesamtfettgehalt der meisten Fische ist relativ niedrig. Ausgenommen davon sind zum Beispiel Aal, Hering und Makrele. Fischfett ist ein besonders gesundes Fett. Insbesondere See-
Gesellig Ein gesundheitlich förderlicher Faktor sind die Gebräuche beim gemeinschaftlichen Speisen. Ob Sushi oder Suppe: Niemand bestellt sich ein Gericht für sich allein. Das Prinzip heißt „alles für alle“, und das ist nicht nur gesellig, sondern regt auch zur Mäßigung an, denn schließlich soll jeder probieren können.
Schon lange bevor Vitamine und Mineralstoffe von Wissenschaftlern erforscht wurden, war das asiatische Essen nährstoff und ballaststoffreich, mit wenig Zusatzstoffen und fettarm.
Fettarm Die Zubereitung der Speisen ist aus ernährungswissenschaftlicher Sicht vorbildlich: Gemüse und Fisch kommen meist roh oder mariniert (eingelegt) auf den Tisch. Das spart Fett, erhält das Aroma und die Nährstoffe. Gekocht oder gebraten wird im Wok – auch das ist fettsparend. Dazu kommen die fettarmen Zutaten. Der allgegenwärtige Reis liefert die wichtigen Kohlenhydrate und enthält nur sehr wenig Fett, dafür aber zahlreiche B-Vitamine. Ebenso zum Dessert, wenn es eines gibt, werden statt fettreicher Dickmacher wie Pudding oder Sahnedesserts Früchte serviert.
Fisch statt Fleisch Japaner essen etwa fünfmal so viel Fisch wie Deutsche; zudem beläuft sich der durchschnittliche Fleischverzehr eines Japaners auf nur etwa 25 Prozent dessen, was ein Deutscher verspeist. Fische
uchen einfach nur zuzugreifen.
Die Nahrung übt langfristig einen größeren Einfluss auf das Wohlbefinden und die Gesundheit aus als jeder andere Aspekt unseres Lebens.
FOTO: FOODPIX
fische enthalten die wichtigen Omega3-Fettsäuren. Diese Fettsäuren kann der menschliche Körper nicht selber herstellen. Er ist auf die Aufnahme über die Nahrung angewiesen. Wissenschaftler fanden in einer Studie heraus, dass für Menschen das Risiko, einen Herzinfarkt zu erleiden, durch die Omega-3Fettsäuren des Seefischs bis zu 44 % geringer ist. Daher sollten mindestens ein-
mal pro Woche, besser zweimal wöchentlich Thunfisch, Makrele oder Lachs auf dem Speiseplan stehen. Den positiven Einfluss von Omega-3-Fettsäuren auf Entzündungen im Körper konnten japanische Forscher nachweisen. Omega-3Fettsäuren haben insgesamt einen positiven Einfluss auf Herz und Kreislauf. Außerdem sind sie für die Ausbildung und Entwicklung des menschlichen Gehirns von großer Bedeutung. Damit sind Omega-3-Fettsäuren für alle Menschen zu empfehlen, vor allem jedoch für Kinder und Schwangere, da sie einen erhöhten Bedarf an diesen
FOTOS AUF DEN SEITEN 32 UND 33: PHOTODISC, DPNY, PHOTOS.COM
33
Frisch, knackig und gesund. Japaner verwenden nur ganz frische Lebensmittel.
sium, Phosphor sowie die B-Vitamine Thiamin (B1), Riboflavin (B2) und Niacin. Besonders beliebt ist Soja in Form von Tofu, einer Art Sojabohnenquark, den es buchstäblich in jeder erdenklichen Form und Geschmacksrichtung gibt. Für viele vielleicht nicht zu glauben: Tofuwürstchen oder Tofuburger schmecken tatsächlich so, als wären sie aus Fleisch hergestellt. Tofu kann jedoch auch als Pastete oder als Käse verwendet werden. Außerdem kann man Tofu frittieren, panieren, kochen, grillen oder pürieren. Im Sommer wird er gern mit Frühlingszwiebeln und geriebenem Ingwer kalt gegessen. Im Winter isst man Tofu dagegen warm, z. B. in Suppen sowie zu Fleisch- und Gemüsegerichten.
Seetang
Einblicke in Japans Küche
Soja
Fettsäuren haben.
Die tolle Bohne
Für Japaner gehören Sojaprodukte seit Jahrhunderten zu den Grundnahrungsmitteln, und sie profitieren in beeindruckender Weise von der gesunderhaltenden Wirkung der Bohnenprodukte. Sie haben, wie wir wissen, eine höhere Lebenserwartung und leiden seltener unter Krebs- und Herzkreislauferkrankungen als Menschen in der westlichen Welt. Untersuchungen haben zudem bestätigt: Japanerinnen kennen wegen ihres hohen Sojakonsums keine Wechseljahresbeschwerden. Dafür sorgen so genannte Phyto-Östrogene. Das sind Pflanzeninhaltsstoffe, die im menschlichen Körper eine ähnliche Wirkung wie körpereigene Östrogene – sogar eine sanftere als diese – haben und auch regulierend auf den Hormonhaushalt
34
FOTOS AUF DEN SEITEN 34 UND 35: PHOTODISC, DPNY, PHOTOS.COM
wirken. Isoflavone sind die wirkungsvollsten unter ihnen. Da Sojaprodukte im Rahmen unserer Ernährungsgewohnheiten jedoch selten verzehrt werden, empfiehlt es sich für Frauen in den Wechseljahren, die schützenden Phyto-Östrogene in Form von Nahrungsergänzungen zusätzlich zuzuführen. Mehr Informationen über Phyto-Östrogene finden Sie in diesem Heft auf der Seite 22 in der Rubrik „Neues aus der Forschung“. Wer nun denkt, dass so etwas Gesundes wie Soja auf keinen Fall schmecken kann, der irrt. Der kulinarische Variantenreichtum von Soja ist beeindruckend. Am besten bekannt ist wohl die Sojasoße, die jedoch kaum Isoflavone enthält. Kosten Sie doch auch einmal Sojanüsse, Sojasprossen oder Sojamilch, die übrigens eine hervorragende Alternative zur Kuhmilch ist. Sojamilch enthält keine Lactose und ist deshalb besonders für Menschen geeignet, die keine Lactose vertragen. Und: Produkte aus Soja sind kalorienarm, fettarm und cholesterinarm und eine gute Quelle für Mineralstoffe wie Calcium, Eisen, Magne-
Das gesunde Gemüse aus dem Meer Mehr als 300.000 Tonnen Meeresalgen ernten die Japaner jährlich. Das grüne Gemüse wird zu Sushi verarbeitet und zu vielen anderen Gerichten als Beilage serviert. Algen werden in Japan wie Gemüse verwendet. Sie sind reich an Vitalstoffen wie Jod, Kalium, Calcium, Eisen und den Vitaminen C und B12. Als Gemüse verzehrt sind Meeresalgen gut für das Herz und wirken entgiftend. Oft sind sie jedoch mit Schadstoffen belastet und von daher nur bedingt zu empfehlen. Von Nahrungsergänzungen, die Meeresalgen enthalten, ist jedoch in jedem Fall abzuraten. Sie enthalten nicht die vollständige Wirkungskraft der gesunden Inhaltsstoffe und sind zum Teil unverhältnismäßig teuer.
Ginseng Die „Menschenwurzel“
Die Ginseng-Wurzel sieht ein bisschen aus wie ein kleines Männchen. Das Wort „Ginseng“ bedeutet auch „Men-
schenwurzel“. Die außergewöhnliche Form hat die Phantasie der Menschen schon immer beschäftigt. Doch noch erstaunlicher als ihre Form ist ihre Wirkung. Ginseng zählt in der traditionellen chinesischen Medizin, die auch in Japan zur Anwendung kommt, zu den ältesten Heilmitteln. Doch er wird zudem oft und gerne in der japanischen Küche verwendet. Zum Beispiel als Tee, als Marmelade oder als Gewürz. Seit mehr als 5.000 Jahren wird seine gesundheitsfördernde Wirkung bereits genutzt. Im Arzneibuch der chinesischen Kaiser steht Ginseng an erster Stelle. Um die Lebenskraft zu erhalten, sollte die Wurzel nach Ansicht chinesischer Heilkundiger ab dem dreißigsten Lebensjahr täglich eingenommen werden. Das Besondere an Ginseng ist, dass die Wurzel immer dort wirkt, wo sich eine körperliche Schwachstelle befindet. Ginseng ist ein so genanntes „Adaptogen“, ein Mittel, das es dem Körper erlaubt, sich besser den jeweiligen Erfordernissen anzuen, indem es die Körperfunktionen in Einklang bringt. Das kann sich z. B. in einer besseren Anung an StressSituationen äußern. Die in der Wurzel enthaltenen Ginsenoside stärken den Herz- und den Blutkreislauf und aktivieren die Widerstands- und Regenerationskraft. Sie fördern die körperliche und seelische Leistungsfähigkeit und können so Erschöpfungszuständen vorbeugen. Diese Wirkungen sind medizinisch bewiesen. Der Wurzel werden noch andere pos i t i v e Eigenschaften zugeschrieben. So soll sie zum Beispiel potenzfördernd wirken, was aber nicht klinisch belegt wurde. Um die heilsamen Wirkstoffe zu bilden, muss die Pflanze mindestens drei, besser noch sechs Jahre wachsen. Heimisch ist Ginseng in Korea, in China, in Sibirien und in Japan. Der koreanische Ginseng gilt allerdings als der beste. Der Anbau ist nicht leicht, denn Ginseng bedarf besonderer Pflege. Das erklärt die relativ hohen Preise, die für die Wurzel v e r l a n g t werden. Von den gesundheitsfördernden
Shiitake-Pilz
Wirkungen des Ginsengs können Sie auch in Form von Phytopharmaka (pflanzlichen Arzneimitteln) profitieren.
Viel Gesundes unterm Hut In der asiatischen Küche wird der auch a l s Heilmittel verwendete Edel-Pilz schon lange als Delikatesse geschätzt. Der schmackhafte Pilz ist seit mehr als 2.000 Jahren bekannt. Er besitzt nicht nur ein unvergleichliches Aroma, sondern versorgt den Körper auch mit einer Vielzahl von Stoffen: hochwertiges Eiweiß, B-Vitamine, Ergosterol (eine Vorstufe des Vitamin D) und jede Menge Mineralstoffe wie Kalium, Calcium, Zink und Eisen. Besonders wertvoll machen ihn aber eine Reihe v o n sekundären Pflanzenstoffen. Sie sollen unter anderem den Blutzucker- und den Cholesterinspiegel positiv beeinflussen, das Immunsystem stärken, hohem Blutdruck entgegenwirken, vor Krebs schützen und der Zellalterung entgegenwirken können. Normalerweise werden in Deutschland die in Japan gezüchteten Pilze verkauft. Es gibt jedoch auch in Deutschland gezüchtete Pilze. Der Shiitake-Pilz braucht sechs Monate, bis er erntereif ist.
Grüner Tee
Der Gesundheitstrank Grüner Tee wird in Japan zu allen Mahlzeiten getrunken und immer und überall angeboten. Grüner Tee ist nicht nur gesund, er steigert auch das allgemeine Wohlbefinden. Und: Er ist ein praktisch kalorienfreies Getränk, das Kalium, Fluor, Mangan sowie die Vitamine B1 und B2 liefert. Je nach Herkunft und Qualität enthalten die Blattknospen und Blätter 1 bis 5 % Koffe-
in, kleine Mengen an Theobromin und Theophyllin, ätherische Öle, 7 % bis 12 % Gerbstoffe sowie andere sekundäre Pflanzenstoffe (Polyphenole). Diese wirken antibakteriell und beugen so Karies vor. Unterstützt wird dieser Effekt von dem im Tee enthaltenen Fluor, das die Zähne zusätzlich vor Karies schützt. Das Koffein des Tees, das früher Teein genannt wurde, ist identisch mit dem des Kaffees, liegt jedoch im Teeblatt in einer anderen Bindungsform vor. Nach dem Aufgießen des Tees mit aufgekochtem und wieder auf ca. 70-80° C abgekühltem Wasser, gehen schon in den ersten beiden Minuten etwa 75 % des Koffeins in den Aufguss über. In diesem Fall herrscht die anregende Wirkung auf das zentrale Nervensystem vor. Bei längeren Brühzeiten (bis zu fünf Minuten) gehen auch die Gerbsäuren in Lösung, die dem Tee eine bittere Note geben. Die Gerbsäuren bilden zusammen mit dem Koffein eine schwer lösliche Verbindung, die vom Körper kaum noch aufgenommen wird – so ist die Wirkung des Koffeins bei Tee, der länger gezogen hat, entsprechend schwächer. Dafür bringen die Gerbstoffe großen gesundheitlichen Nutzen: Sie beruhigen Magen und Darm, haben eine leicht stopfende
Neueste Forschungsergebnisse Wissenschaftler haben jetzt in einer neuen Studie herausgefunden, wie grüner Tee die Entstehung von Krebs blockieren kann. Dass das der Fall ist, war schon länger bekannt, nicht jedoch der Wirkungsmechanismus. Das sind die Ergebnisse: Wenn krebserregende Stoffe in den Körper gelangen, wird ein bestimmtes Eiweißmolekül aktiviert, das zu der krankmachenden Wirkung dieser Stoffe im Körper führt. Zwei Substanzen aus dem Tee-Extrakt fangen diesen Botenstoff jedoch ab und vermindern so die Entstehung von Krebs. Diese sekundären Pflanzenstoffe haben zusätzlich eine hohe antioxidative Wirkung und können Freie Radikale unschädlich machen. Bisher nahm man daher an, dass die krebsvorbeugende Wirkung des grünen Tees ausschließlich der antioxidativen Wirkung der Flavonoide zuzuschreiben sei. Dass sie jedoch noch über weitere Wirkungsmechanismen gegen Krebs verfügen, beweist diese Studie. Mehr dazu auf Seite 15.
35
Drei wichtige Faktoren, die die Qualität einer japanischen Mahlzeit bestimmen Die Frische der Produkte Japaner legen sehr viel Wert auf frische Produkte, besonders bei Fisch.
Die optische Präsentation Man legt Wert auf die Anordnung der einzelnen Bestandteile des Gerichts auf dem Teller, die Komposition der unterschiedlichen Farben des Gemüses und das verwendete Geschirr. Oft versucht man, das Geschirr end zur aktuellen Jahreszeit und zu der Farbe der in der Region blühenden Blumen zu wählen.
Gesunde und natürliche Zutaten sind in der asiatischen Kochkultur sehr wichtig.
Die Vielfältigkeit der Gerichte Je mehr verschiedene Bestandteile ein Gericht enthält, desto qualitativ hochwertiger und kostspieliger ist es. Im Gegensatz zu unseren Essgewohnheiten sind die japanischen Essgewohnheiten dadurch geprägt, dass – anstelle eines Hauptgerichts mit wenigen Beilagen – viele Formen von Fisch, Gemüse, Reis, Nudel etc. in kleinen Portionen gegessen werden.
Schon gewusst? Der Fleischverbrauch in Japan ist deutlich geringer als in Deutschland, doch die Qualität des Fleisches ist sehr hoch. Das teuerste Fleisch ist das des KobeRindes. Damit das Fleisch ganz zart wird, wachsen die Tiere unter besonderen Umständen heran. Die Kühe werden täglich mit Bier gefüttert, bekommen Entspannungsmassagen und erfrischende Wasserduschen im Sommer. Das Bier verringert den Stress der Tiere, und die Massagen wirken entspannend auf die Muskulatur.
FOTO: PHOTODISC
Qualität gehört zur japanischen Mahlzeit
In der asiatischen Tradition ist Ki (oder Qi) die kosmische Energie, die alles durchfließt, die Sonne und ihre Planeten, die Luft, alle Gegenstände, Tiere, Pflanzen und jeden Menschen. Auch jede Art von Nahrung enthält ihr eigenes Ki.
B U C H - T I P P
Steven Saunders & Simon Brown „feng shui food“ Christian Verlag, 180 Seiten, ca. 20,50 Euro Ryuichi Yoshii „Sushi Rezeptbuch“ Collection Rolf Heyne , 112 Seiten,
FOTO: TONY STONE
ca. 22 Euro
36
Vitalstoffe auf japanisch Die Japaner glauben, dass beim Essen alle Sinne angesprochen werden sollten. Daher werden die Speisen immer mit besonderer Sorgfalt zubereitet und schön serviert. Sushi, die kleinen Meisterwerke aus der traditionellen japanischen Küche, gelten in Japan als eine Kunstform. Doch Sushi können auch so einfach sein, dass sie jeder selbst zu Hause zubereiten kann. Wie dieses köstliche Rezept zum Beispiel.
Maki-Sushi
(Für 4 Personen)
Zubereitung
FOTO: DPNY
Einfach die Füllung auf das Blatt legen und dann einrollen.
Zutaten
§
Lecker, leicht und leicht gemacht: Sushi aus eigener Küche
§
Nährwertangaben
§
200 g
§
japanischer Sushi-Reis (oder Milchreis) 100 g frischer Thunfisch 100 g frischer Seebarsch 8 bis 10 Blätter Nori (getrockneter Seetang) 8 mittelgroße Shrimps 3 Radieschen 1 Bambus-Rollmatte (oder Frischhaltefolie) 1 Schale mit einem Reisessig-Wasser-Gemisch (anstelle von Reisessig kann auch Apfelessig verwendet werden) Wasabipulver (oder geriebener Meerrettich) Frühlingszwiebeln Frischer Ingwer Zum Dippen: Sojasoße
FOTO: DPNY
§
Den Fisch in ca. 4 cm dicke lange Streifen schneiden. Die Shrimps schälen und dabei jeweils den schwarzen Darmfaden entfernen. Die Frühlingszwiebeln putzen, waschen und in Streifen schneiden. Den Ingwer und die Radieschen in Scheiben schneiden. Den Sushi-Reis mit etwas Reis-Essig in Wasser so lange kochen, bis er klebrig und weich wird. Danach abkühlen lassen. Die Hände gründlich mit dem Essig-Wasser-Gemisch befeuchten, damit der Reis nicht an den Händen kleben bleibt. Zum Aufrollen können Sie statt einer Bambus-Rollmatte auch Frischhaltefolie benutzen. Verwenden Sie für die Sushi-Rollen drei verschiedene Füllungen – jeweils Thunfisch, Seebarsch oder Shrimps. Ein Nori-Blatt auf der Rollmatte bzw. Frischhaltefolie auslegen und den Reis daraufgeben. In die Mitte legen Sie den Fisch, die Frühlingszwiebeln, die Radieschen und etwas Ingwer. Abschließend etwas Wasabipulver bzw. geriebenen Meerrettich darauf verteilen. Vorsichtig aufrollen. Dann die Rolle in ca. 5 cm lange Stücke schneiden. Zusammen mit 4 Schälchen, die mit Sojasoße gefüllt sind, anrichten.
(Pro Portion) Energie Eiweiß Fett Kohlenhydrate Ballaststoffe
295 kcal 21 g 3 g 42 g 2 g
Vitamin B1 Vitamin B2 Vitamin B6 Vitamin C Vitamin D Magnesium Calcium Cholesterin
0,1 0,1 0,4 9 2,8 58 64 82
mg mg mg mg µg mg mg mg
37
Leserbriefe Liebe MEDICOM-Leser, möchten Sie kritisch oder zustimmend zu einzelnen Themen im Heft Stellung nehmen? Oder interessante Tipps zum Thema „Gesund werden – gesund bleiben“ an andere Leser weitergeben? Dann schreiben Sie uns! Unsere Anschrift lautet: MEDICOM-Redaktion, Sedemünder 2, Altenhagen I, 31832 Springe.
seite stellt der ADC alle sieben kirchlichen und weltlichen deutschen Chorverbände vor. So kann sich jeder nach seinem Geschmack vororientieren und dann natürlich über die eingerichteten Links ganz nach seinen Wünschen weitergehen. Er/sie wird viele Möglichkeiten entdecken – und das in der Regel umsonst oder zu sehr günstigen Preisen. Wem es nicht behagt, im Internet auf die Suche zu gehen, der kann sich auch gern auf traditionellem Wege mit seinen Fragen an die ADC wenden. Die Adresse lautet: ADC, Adersheimer Str. 60, 38304 Wolfenbüttel. Tel.: 0 53 31/4 60 18 Fax: 0 53 31/ 4 37 23 Mit besten Grüßen R. Pasdzierny, Geschäftsführer des ADC Sehr geehrter Herr Pasdzierny,
Singen Medicom 25 Schön, dass Sie dem so wichtigen Thema Singen in der MEDICOM-Kundenzeitschrift Raum gegeben haben. Wenn es nicht schnell und nachhaltig zu einer Rückbesinnung darauf kommt, wie wichtig Musik und speziell das Singen für das menschliche Leben ist, dann kann das negative Folgen für die Gesundheit des Einzelnen und für die Gesellschaft im Ganzen haben. Vor allem unseren Kindern sollte es baldmöglichst wieder deutlich gemacht werden, dass Musik nicht nur darin besteht, einen Kopfhörer aufzusetzen und sich berieseln zu lassen. Nur das eigene aktive Singen und Musizieren eröffnet den wahren Horizont der Möglichkeiten von Musik. Zum Glück zeichnet sich in letzter Zeit ein positiver Wandel ab. Unter anderem hat sich der Bundespräsident höchstpersönlich für die Musik eingesetzt. Am 09.09.2003 lud er zu einem Projekttag „Musik für Kinder“ in seine Berliner Residenz. In Schloss und Park Bellevue zeigten an diesem Tag Hunderte von Kindern, was sie musikalisch konnten und wie viel Spaß sie dabei hatten. Bun-
38
MEDICOM 27. Ausgabe, Dezember 2003
despräsident Rau wollte damit ein Zeichen setzen für die dringende Notwendigkeit der Rückbesinnung darauf, dass aktives Musizieren und Singen wieder einen selbstverständlichen Platz im schulischen und außerschulischen Alltag von Kindern (und Jugendlichen und Erwachsenen) haben müssen. Auch im Bereich des organisierten Singens in Chören gibt es Strukturveränderungen: Männerchöre alter Prägung z. B. gibt es immer weniger; aber die Zahl der Kinder- und Jugendchöre steigt. Und es ist eine ganz neue Form von Chören entstanden: die Projekt- oder Telefonchöre. Hier trifft man sich nicht mehr regelmäßig, immer am gleichen Ort. Vielmehr plant man ein bestimmtes Projekt, telefoniert sich zu einer ausgiebigen Probenphase zusammen, gibt einige Konzerte und geht dann wieder auseinander – bis zum nächsten Mal. Mein zusätzlicher Tipp zu den von Ihnen gegebenen Informationsquellen zum Thema Singen in Chören: die Homepage der Arbeitsgemeinschaft deutscher Chorverbände, ADC, im Internet unter der Adresse www.adc-chorverbände. Im ADC sind alle Chorverbände Deutschlands zusammengeschlossen. Auf der Internet-
herzlichen Dank für Ihre umfangreichen und kompetenten Informationen, die unsere Leser sicher sehr erfreuen werden. Mit den von Ihnen gegebenen Informationen an der Hand, finden interessierte Leser bestimmt leicht einen enden Chor. An der positiven und umfangreichen Resonanz unserer Leser auf den MEDICOM-Artikel über das Singen haben auch wir festgestellt, wie sehr das Thema „die Gemüter bewegt”. Ein Zeichen für das große Bedürfnis nach dem Singen ist auch die gesteigerte Medienpräsenz von Gesangswettbewerben und Talentshows im Fernsehen. Es beginnt sich offensichtlich ein „Pro-SingenTrend“ zu etablieren, der sehr zu begrüßen ist. Wir wünschen Ihnen und Ihrer Arbeitsgemeinschaft weiterhin viel Spaß und Erfolg!
Impressum Herausgeber:
Verlag, Redaktion, Gestaltung: Druck:
Medicom Pharma AG Sedemünder 2, Altenhagen I 31832 Springe Tel. (0 50 41) 78-0 Fax (0 50 41) 78-11 69
DPNY communications Hofmann-Druck
„MEDICOM“ ist eine Kundenzeitschrift der Medicom Pharma AG; sie erscheint fünfmal jährlich. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung des Herausgebers.
Wir behalten uns vor, Leserbriefe zu kürzen. Für unverlangt eingesandte Manuskripte, Fotos und Illustrationen kann keine Haftung übernommen werden.
1. Preis: Gesundheitsferien in der Klinik im Hofgarten
Lösung:
Kreuzworträtsel Liebe Rätselfreunde, diesmal geht es bei dem Lösungswort um etwas, das sehr gut für die Augen ist. Tragen Sie die Buchstaben in den nummerierten Feldern in der richtigen Reihenfolge ein. 1. Preis: eine Woche Gesundheitsferien in der Klinik im Hofgarten, Bad Waldsee, für zwei Personen im Wert von 1.300,– Euro. 2. bis 4. Preis: je ein Rezeptbuch „Sushi“ aus der Collection Rolf Heyne
Lösungen aus dem Mai-Heft
Und so können Sie gewinnen Haben Sie das richtige Lösungswort? Dann schreiben Sie es auf eine Postkarte, und schicken Sie diese an: MEDICOM-Redaktion, Stichwort: „Preisrätsel“, Sedemünder 2, Altenhagen I, 31832 Springe. Einsendeschluss ist der 31.12.2003 (Datum des Poststempels). Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Mitarbeiter der Medicom Pharma AG und deren Angehörige dürfen nicht teilnehmen. S C H O N
G E W U S S T ?
Affentheater Straßenraub, Taschendiebstahl, Hausfriedensbruch, Raubüberfälle, Plünderungen in affenartiger Geschwindigkeit: In Japan hat man es mit einer bislang unbekannten Form krimineller Energie zu tun, einer tierischen. Organisierte Affenbanden machen Naturschutzgebiete unsicher. Die Makaken stürmen Autos, reißen Touristen die Taschen aus den Händen, überfallen Spaziergänger und plündern sogar in Supermärkten. „Daran sind die Touristen schuld“, sagt ein Affenforscher. „Die Affen haben sich daran gewöhnt, dass ihnen die Touristen leckeres Futter geben, und wenn es nun nicht reicht, dann holen sie es sich einfach.“
Inzwischen dürfen die Touristen „dem Affen keinen Zucker mehr geben“. Der Magistrat hat das Füttern der Primaten verboten.
FOTO: DPNY, PHOTODISC
MEDICOM – immer an Ihrer Seite „Ihre Gesundheit ist unsere Aufgabe“ – das ist unser Motto. Die MEDICOM steht Ihnen mit sinnvollen Produkten in Ihrem Alltag zur Seite. Wir wollen, dass Sie Ihren Tag mit der Gewissheit erleben, Ihre Gesundheit aktiv zu unterstützen. Mit den Produkten von MEDICOM können Sie Ihre Gesunderhaltung auf anspruchsvollem Niveau fördern. Ob Sie bei Ihrer Vitalstoffversorgung auf Nummer Sicher gehen wollen oder ob Sie einen bestimmten Bedarf Ihres Körpers gezielt ausgleichen wollen – wir versuchen Ihnen immer das zu bieten, was Ihnen und Ihrer Gesundheit dienlich ist. Haben Sie Fragen zum Thema „Gesundheit und Vitalstoffe“? Die Mitarbeiter unserer wissenschaftlichen Abteilung werden Ihnen gerne all Ihre Fragen in einem persönlichen Gespräch am Telefon beantworten. Auch unser Kundendienst gibt Ihnen gern Auskunft zu unseren Produkten. Sie erreichen beide unter einer gebührenfreien Telefonnummer. Ihre Zufriedenheit und Ihre Gesundheit stehen bei der Medicom Pharma AG an erster Stelle. Unser Bestreben ist es, Ihrem Vertrauen, das Sie uns als Kunde entgegenbringen, in jeder Form gerecht zu werden – sowohl
mit unseren hochwertigen Produkten als auch mit sinnvollen Serviceleistungen. Bei der Herstellung unserer Produkte verwenden wir nur die hochwertigsten Rohstoffe – damit die Wirkstoffe vom Körper optimal genutzt werden können. Die Herstellung erfolgt nach dem strengen GMP-Standard. Wenn Sie ein Produkt der MEDICOM erwerben, dann entscheiden Sie sich für Qualität. Bei der MEDICOM endet die Beziehung zum Kunden nicht mit der bezahlten Rechnung. Mit unseren Serviceleistungen – die weit über das Übliche hinausgehen – wollen wir Ihr Partner in Sachen Gesundheit sein: Sie bekommen als Kunde 5-mal im Jahr das Kundenmagazin MEDICOM. Sie erhalten auf all unsere Produkte eine Geld-zurück-Garantie. Sie erhalten Ihre Produkte innerhalb von 48 Stunden frei Haus gegen Rechnung. Sie können unsere Produkte per Post, per Fax, am Telefon und im Internet anfordern. Und als Sammelbesteller erhalten Sie einen interessanten Preisnachlass. Wir wollen alle Ihre Bedürfnisse in Sachen Gesundheit befriedigen und Ihnen in Ihrem täglichen Leben zur Seite stehen. Wir sind für Sie da. Wir sind Ihr Partner in Sachen Gesundheit.
Im Internet: www.medicom.de • Kostenlose Ernährungsberatung: 0800 73 77 730